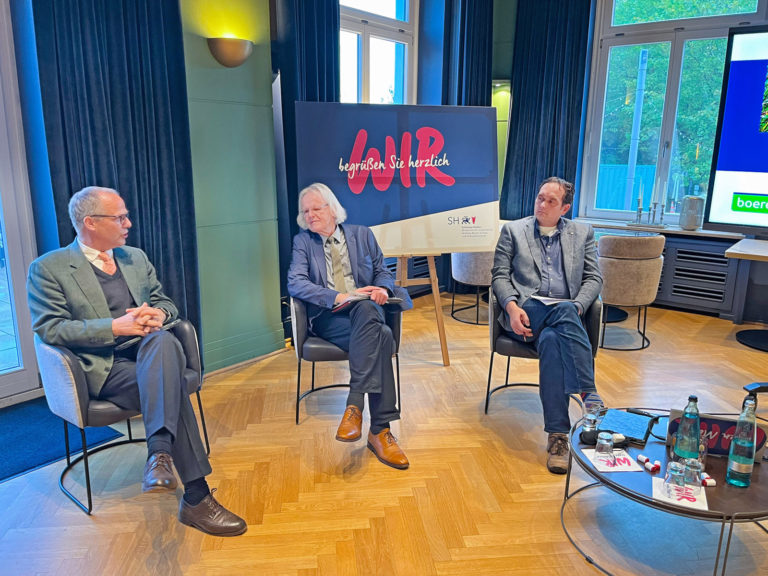Schokolade macht glücklich! Was gibt es Schöneres, als an einem nasskalten Herbsttag, eingekuschelt in eine Decke, ein Stückchen Schokolade langsam im Mund zergehen zu lassen? Dabei denken wir meist nicht daran, dass es viel Handarbeit braucht, bis aus bitteren Kakaobohnen zart schmelzende Köstlichkeiten werden können. Verfolgen wir deshalb ihren Weg vom tropischen Regenwald bis zum fertigen Produkt und besuchen dafür das Hamburger Schokoladenmuseum Chocoversum.
Foto: Silke Bromm-Krieger
Unsere Genussreise beginnt im tropischen Regenwald, genauer gesagt in Westafrika. Rund 70 % der weltweiten Ernte kommen von dort, hauptsächlich von der Elfenbeinküste und Ghana. Hier gibt es das optimale, feuchtwarme Klima, das die Kakaobäume wachsen und gedeihen lässt. Angebaut wird der Kakao überwiegend von Kleinbauern auf Flächen zwischen 1 und 3 ha. Der Kakao ist oft die einzige Einnahmequelle dieser Familienbetriebe. Zweimal im Jahr können sie ernten, zum Ende der Regenzeit und zu Beginn der nächsten Regenzeit.
Der Kakaobaum (Theobroma cacao) trägt ganzjährig. Die Blüten wachsen direkt am Stamm oder an dickeren Ästen. Mücken sorgen dafür, dass sie bestäubt und befruchtet werden. Eine Besonderheit ist, dass Kakaofrüchte in unterschiedlichen Reifezuständen gleichzeitig am selben Baum hängen. Nach der Befruchtung entwickeln sich je nach Sorte rotbraune, violette oder gelbe Früchte, die eine Länge von etwa 30 cm erreichen. Jede Kakaofrucht enthält 40 bis 50 Kakaobohnen, die in weißes Fruchtfleisch eingebettet sind. Reife Früchte werden mit Macheten oder Messern an langen Stäben vorsichtig von den Bäumen gelöst und zentral an einer Stelle gesammelt. Die Bauern öffnen sie und lösen aus ihnen die Kakaobohnen mit einem Teil des Fruchtfleisches heraus.
Foto: Silke Bromm-Krieger
All das erfahren Besucher an diesem Tag von Schoko-Guide Sophia während einer 90-minütigen, interaktiven Tour durchs Chocoversum. Auch kritische Aspekte des Kakaohandels von der Geschichte bis zur Gegenwart wird sie dabei nicht auslassen. Die Teilnehmenden werden an mehreren Stationen etwas über die Produktionsschritte und Maschinen zur Verarbeitung des süßen Goldes erfahren und bei Verkostungen eigene Geschmackserlebnisse machen. Aber von vorn. Zu Beginn verteilt Sophia eine Waffel, die jeder zur Einstimmung unter einen Schokobrunnen halten darf.
Doch von der frisch geernteten Kakaofrucht bis zur fertigen Schokolade ist es bekanntlich ein langer Weg. Und so steht nach der Ernte die Fermentation der Kakaobohnen auf dem Plan, für die es unterschiedliche Verfahren gibt. Entweder liegen die Bohnen dafür in Bananenblätter gehüllt oder auf Matten aus, oder sie werden in Holzkisten oder Fässer gefüllt. Während der Fermentation gären sie und entwickeln Temperaturen von bis zu 50 °C. Dabei zersetzt sich das Fruchtfleisch durch Wärme und chemische Prozesse. Die Kakaobohnen, die zurückbleiben, erhalten dadurch ihre braune Färbung und entwickeln eine Vorstufe des typischen Aromas, gleichzeitig werden Keime beseitigt. Anschließend müssen sie ein bis zwei Wochen trocknen, wobei sich ihr Gewicht um mehr als die Hälfte reduziert. Ebenso verbessern sich während dieser Zeit Haltbarkeit und Geschmack, enthaltene Säure wird abgebaut. Für den Trocknungsprozess setzen die Bauern auf Sonnen- oder Ofentrocknung. Erst wenn der Feuchtigkeitsgrad der Kakaobohnen maximal 7 % beträgt, können sie, nach Qualitäten sortiert, in Jutesäcke abgefüllt werden.
Foto: Chocoversum/Repro Silke Bromm-Krieger
„Die Weiterverarbeitung des Rohkakaos geschieht nicht in den Anbauländern, sondern in Europa und Nordamerika“, weiß Sophia. So macht sich von Westafrika irgendwann auch ein Schiff mit der kostbaren Fracht auf den Seeweg nach Deutschland. Hier kommt die Hansestadt Hamburg als „Schokoladenhauptstadt“ ins Spiel. Über ihren Hafen gelangen, laut Chocoversum, jährlich rund 150.000 t Rohkakao ins Land. „Sobald die Kakaobohnen bei den Schokoladenproduzenten angekommen sind, werden dort Stichproben genommen und diversen Tests unterzogen“, informiert Sophia. Weisen die Bohnen Schäden auf? Gibt es Schimmel oder Insektenbefall? Bestehen die Kakaobohnen diese erste Inspektion, werden sie maschinell gereinigt und heiß geröstet. „Beim Röstvorgang bilden sich bis zu 400 verschiedene Kakaoaromen aus“, erklärt sie. Danach werden in einer Brechmaschine die Schalen der Kakaobohnen in kleine Stücke gebrochen und anschließend durch einen Luftstrom fortgeblasen. Übrig bleibt der Kakaokernbruch, auch Nibs genannt.
Nun erfolgt das erste feine Mahlen, bei dem aus den Nibs Kakaobutter austritt. Sie lässt die Kakaomasse schmelzen. Doch in diesem Stadium ist sie noch nicht fein genug. Auf der Zunge würde sie sich sandig und krümelig anfühlen. Damit das nicht passiert, werden die Kakaostückchen in Walzwerken weiter schrittweise auf klitzekleine Kakaopartikel reduziert. Vorher kommen je nach Rezept Zutaten wie Zucker, Milchpulver oder Lecithin hinzu. Sophia bleibt vor zwei alten Maschinen stehen, die diese Arbeit erledigen, und erläutert sie. Im Anschluss wird das Walzgut in die Conchiermaschine (Conche) umgefüllt, auf bis zu 90 °C erwärmt und konstant geknetet und gerührt. Das kann Stunden bis Tage dauern. So wird der gute Geschmack weiter herausgearbeitet, die flüssige Masse wird glatt und fein schmelzend. Nun ist sie bereit, in die gewünschte Form gegossen und im abgekühlten Zustand für den Handel verpackt zu werden. Aber vorher dürfen die Besucher die Schokolade in den Sorten Vollmilch und Zartbitter auf einer Waffel probieren. Hmm, lecker!
Einige Anmerkungen seien noch zu den Qualitäten von Schokolade gemacht: Je nach Kakaoanteil schmeckt sie kräftig-herb bis sehr süß. Bitterschokolade enthält einen Kakaoanteil von 70 % und mehr, Zartbitterschokolade von 55 %, Vollmilch- oder Milchschokolade von 30 bis 45 %. Die weiße Schokolade enthält neben Milchpulver und Zucker nur 30 % Kakaobutter, jedoch keinen Kakao. Je weniger Zutaten Schokolade hat und je höher ihr Kakaoanteil, desto hochwertiger das Produkt.
Foto: Silke Bromm-Krieger
Abschließend sei das Highlight der Schokotour erwähnt: In der Schokowerkstatt des Museums können sich kleine und große Naschkatzen ihre eigene Tafel aus flüssiger Zartbitter-, Vollmilch- oder weißer Schokolade in eine Form gießen lassen und selbst mit ihren Lieblingszutaten verzieren. Diese Aktion ist im Eintrittspreis enthalten. „Dafür stehen bunte Smarties, Haselnuss-Krokant, Erdnuss-Crumble, Wasabi-Erbsen und verschiedene bunte Zuckerstreusel bereit“, berichtet Sophia. Die individuell verzierten Tafeln können am Ende der Führung mitgenommen werden. Ein tolles Erlebnis, das bei manchen Besuchern bestimmt Lust auf mehr macht. Weitere Infos unter chocoversum.de und schokoinfo.de
Hintergrund:
Im Jahr 2022 genoss jeder Deutsche durchschnittlich 8,92 kg Schokolade. Deutschland ist auch Exportweltmeister von Schokoladenprodukten. Knapp 10 % der weltweiten Kakaoernte werden hier verarbeitet.
Foto: Silke Bromm-Krieger
Doch ein Blick auf das Leben der rund 5,5 Millionen Kakaobauern in den Herkunftsländen zeigt, dass sie von ihrer Arbeit kaum existenzsichernd leben können, die Mehrheit lebt aktuell unterhalb der Armutsgrenze. Verbraucher sollten beim Schokoladenkauf deshalb bevorzugt auf Produkte mit Fair Trade-Siegeln zurückgreifen, zertifiziert beispielsweise nach Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade oder einem Bio-Standard. Allerdings kann die Zertifizierung allein kein existenzsicherndes Einkommen für die Kleinbauern gewährleisten.
Foto: Forum Nachhaltiger Kakao
Deshalb fördert das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung das Projekt „Pro Planteurs“, das Bauern und speziell Bäuerinnen in nachhaltiger Kakaoerzeugung schult und so vor Ort Perspektiven schafft. Im „Forum Nachhaltiger Kakao“ engagieren sich zudem die Süßwarenindustrie, der Lebensmittelhandel, die Zivilgesellschaft und die Bundesregierung für einen nachhaltigen Kakaoanbau. Sie verfolgen das Ziel, die Lebensumstände der Kakaobauern und ihrer Familien zu verbessern, sowie den Anbau und die Vermarktung nachhaltig erzeugten Kakaos zu erhöhen. Mehr unter kakaoforum.de und bmel.de (Quellen: Statista, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL)