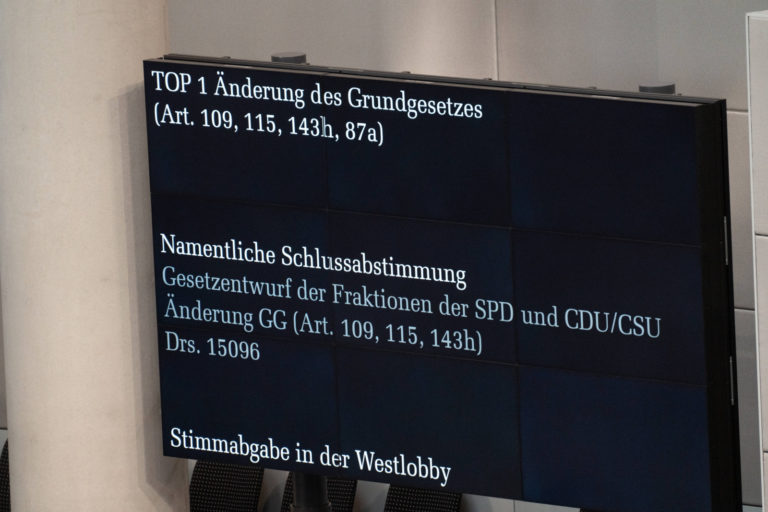Das Erdmandelgras (Cyperus esculentus) ist eine Wärme liebende, mehrjährige Pflanze und gehört zur Familie der Sauergräser. Seine Verbreitung ist auf dem Vormarsch. Welche Maßnahmen können zur Bekämpfung ergriffen werden?
Erdmandelgras kann eine Wuchshöhe von zirka 1 m erreichen, die Blätter sind v-förmig und hellgrün bis grau, der Stängel ist dreikantig, markhaltig und ohne Knoten. Die Heimat dieses Sauergrases ist Ostafrika. Als Neophyt konnte sich die Pflanze bereits auf allen Kontinenten verbreiten, mittlerweile sind in Niedersachsen rund 200.000 ha befallen. Dieser Artikel ist daher auch für Schleswig-Holstein interessant.
Besonders unter nassfeuchten Bedingungen kann sich das Erdmandelgras rasch vermehren. Es nutzt dabei eine besonders effektive Technik, sich zu verbreiten: Einerseits werden Mandeln als Überdauerungsorgan gebildet, hiervon ausgehend werden vegetative Nebentriebe über die Ausbildung von Rhizomen entwickelt. Die Keimfähigkeit der Mandeln ist mehrere Jahrzehnte gegeben. Andererseits gibt es noch die generative Vermehrung über die Samenbildung, die aber im Vergleich zur Vermehrung über Mandeln und Rhizome einen deutlich geringeren Teil ausmacht. Die Mandeln des Erdmandelgrases befinden sich im Bodenhorizont bei zirka 10 bis 15 cm, sind 3 bis 5 mm groß und braun gefärbt. Die im Boden vorhandenen Mandeln keimen ab einer Bodentemperatur von 8 bis 10 °C im Frühjahr vornehmlich in den oberen 15 Bodenzentimetern, vereinzelt auch in bis zu 100 cm Tiefe.
Die größten Ausbreitungsmöglichkeiten hat das Erdmandelgras in Beständen mit Hackfrüchten wie Zuckerrübe, Mais und Kartoffeln. In diesen Früchten läuft das Wachstum des Erdmandelgrases mit der Kultur parallel, sodass die Konkurrenz um Nährstoffe, Wasser und Licht intensiv ist und die Ertragseinbußen hoch sind. Hingegen ist das Wachstum des Sauergrases in konkurrenzstarken Winterraps- und Wintergetreidebeständen deutlich gehemmt, mit Ausnahme von lückigen Beständen oder Fahrgassen.
Aus den primären Knospen der Knollen entstehen Mutterpflanzen. Nach wenigen Wochen wachsen aus den Mutterpflanzen unterirdische, 6 bis 60 cm lange Rhizome, die bis zu 33 Internodien haben können. Am Ende dieser Rhizome bilden sich Tochterpflanzen. Mit zunehmender Tageslänge und Wärme werden zunächst viele Tochterpflanzen gebildet. Zum Ende der Vegetationszeit bei Tageslängen unter zwölf Stunden werden an abwärtsgerichteten Rhizomen die Knöllchen gebildet. Sie stellen die Überdauerungsorgane dar und können Temperaturen bis zu –15 °C überstehen. Die oberirdischen Pflanzenteile und die Rhizome sterben bei 0 °C im Herbst und Winter ab. Über die Anzahl der pro Pflanze gebildeten Knöllchen gibt es unterschiedliche Angaben in der Literatur.
Eigene Erhebungen zeigen, dass sich aus einer Mandel in nur acht Wochen sieben Tochterpflanzen bilden konnten.
Die Blüten sind gelb bis bräunlich und bilden Ährchen. Das Erdmandelgras blüht von August bis September, bei günstigen Bedingungen auch schon ab Juli. Danach werden die 1 bis 1,5 mm großen Samen gebildet. Verglichen mit den Mandeln sind sie vergleichsweise klein und oft mit bloßem Auge nicht zu erkennen.
Die Kulturform des Erdmandelgrases kommt auf allen Kontinenten vor und wird nach wie vor in Spanien zur Gewinnung seiner Mandeln angebaut. Diese Form unterscheidet sich durch ihre Frostempfindlichkeit von der problematischen Unkrautform. Das Erdmandelgras kann mit dem Knolligen Zyperngras (Caperus rotundus) verwechselt werden. Die Knöllchen sind bitter. Sie werden in der Mitte der Rhizome gebildet und nicht endständig. Zwei weitere Pflanzen, mit denen das Erdmandelgras verwechselt werden kann, sind das Hohe Zyperngras (Cyperus longus) und die Behaarte Segge (Carex hirata). Das Hohe Zyperngras hat dickere Rhizome ohne Knöllchen. Die Behaarte Segge weist eine leichte Behaarung auf den Blättern auf und bilden keine Knöllchen. Es gibt männliche und weibliche Blüten bei der Behaarten Segge.
Schwierige Bekämpfung von Erdmandelgras
Aufgrund der besonderen Vermehrungsstrategie des Erdmandelgrases ist eine nachhaltige und vollständige Bekämpfung fast unmöglich. In erster Linie muss die Verschleppung durch Maschineneinsatz und Ernteprodukte auf Nachbarflächen verhindert werden. Das Erdmandelgras wird sehr leicht durch die Bodenbearbeitung aus den Befallsnestern in Bearbeitungsrichtung mitgenommen. Alle Geräte, die auf mit Erdmandelgras befallenen Flächen eingesetzt werden, sowie das Schuhwerk müssen komplett von anhaftenden Bodenteilchen und Knöllchen sowie gegebenenfalls Samen noch an Ort und Stelle auf der Befallsfläche gereinigt werden. Befallene Flächen müssen immer zuletzt bearbeitet und beerntet werden. Besondere Vorsicht gilt bei überbetrieblichem Maschineneinsatz und für Lohnunternehmer.
Auch der Aushub aus Gräben sowie Überschwemmungen können zu einer Verbreitung auf benachbarte Flächen beitragen. Alle Personen, die auf der befallenen Fläche arbeiten, müssen über bekannte Befallsherde informiert werden, damit sie ihre Einsatzplanung darauf ausrichten können. Das Erdmandelgras verschleppt sich nicht nur über Mandeln, sondern auch über Samen. Vögel nehmen die Samen auf und über deren Ausscheidungen verbreitet sich das Schadgras.
Verschleppung vorbeugen – Hygiene beachten
Von herausragender Bedeutung zur Vorbeugung eines Befalles mit Erdmandelgras ist die Betriebshygiene. Grundsätzlich sollte eine weitere Ausbreitung des Erdmandelgrases über Maßnahmen zur Feld- und Maschinenhygiene verhindert werden, wobei die Reinigung von Erntemaschinen wie Kartoffel- oder Rübenrodern im Spätherbst leichter gesagt als getan ist. Maschinen sind nach einem Einsatz auf der Befallsfläche gründlich zu reinigen, ein „Abrütteln“ reicht nicht. Statt der Verwendung von Druckluft ist eine Reinigung durch intensives Abwaschen mit viel Wasser eindeutig zielführender. Es darf kein Substrat von Befallsflächen auf nicht befallene Flächen gelangen. Ernteprodukte (zum Beispiel Zuckerrüben, Möhren) und Pflanzgut (zum Beispiel Kartoffeln, Gemüsepflanzen, Blumenzwiebeln und -knollen, Baumschulerzeugnisse und Zierstauden) müssen ebenfalls kontrolliert werden.
Größere Befallsflächen sollten zuletzt geerntet werden und langfristig sollte geprüft werden, ob die Fruchtfolge auf den Befallsflächen umgestellt werden kann. Das bedeutet, statt Hackfrüchten eher eine Getreide-Raps-Fruchtfolge zu fahren. Tritt Erdmandelgras in Zuckerrüben oder Mais auf, kann mechanisch durch flaches Hacken im Rübenzwischenraum versucht werden, das Erdmandelgras abzuschneiden und damit die Pflanzen zu schwächen.
Was kann man dagegen tun?
Sind erst einzelne Ecken einer Fläche betroffen, lassen sich Einzelpflanzen händisch tief ausgraben (bis unter die Pflugsohle von 30 cm) und im Restmüll vernichten. Etwas größere Befallsstellen sind zeitnah auszukoffern, bevor weitere Rhizome gebildet werden, und ebenfalls zu vernichten. Befallsstellen sollten markiert und im kommenden Jahr nachkontrolliert werden.
Die Bodenbearbeitung bei Erdmandelgrasbefall wird mit dem Ziel durchgeführt, Knollen auszugraben, sie auszutrocknen und damit auszuhungern (Schwarzbrache). Eine zweijährige Schwarzbrache kann die Knöllchen um bis zu 90 % bekämpfen. Hierbei ist darauf zu achten, dass keine zu tiefe Bearbeitung erfolgt. Es sollte möglichst keine Pflugfurche auf Befallsflächen geben. Sollte diese jedoch erforderlich sein, sollte besser im Frühjahr gepflügt werden, da über Winter Knöllchen in den oberen Bodenschichten absterben können. Flächig begrenzte Stellen kann man brachliegen lassen (Schwarzbrache).
Die Entwicklung vom Erdmandelgras wird bei starker Beschattung gehemmt. In lückenlosen, kräftigen Grünlandbeständen, die mehrmals geschnitten werden, sind die Knöllchenbildung und die Bildung von Tochterpflanzen vermindert oder ganz unterbunden. Fruchtfolgen mit stark beschattenden Pflanzen wie Hanf, Wintergerste und Mais sollten daher bevorzugt werden, die Fahrgassen stellen jedoch immer ein Problem dar. Der Anbau von Kartoffeln, Zuckerrüben und Gemüsekulturen (beziehungsweise Wurzelgemüse) ist nicht zu empfehlen, besser sind Getreide, Mais und Grasanbau. Eine Dauerbegrünung sollte mindestens zwei bis drei Jahre andauern.
Erdmandelgras gehört zu den Sauergräsern. Daher haben die typischen Gräserherbizide keine nachhaltige Wirkung gegen die Pflanze. Der Einsatz von Glyphosat nach der Ernte und gegebenenfalls vor der Saat ist jedoch möglich. Vorteile von Herbiziden zeigen sich eher bei späteren Anwendungsterminen, wenn das Sauergras ausreichend Blattmasse besitzt. Die wesentliche Frage, ob es nach der deutlichen Kontrolle des Sprosses des Erdmandelgrases zu einem Wiederaustrieb aus intakten Mandeln kommt, wird derzeit noch in Versuchen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen geprüft.
In Mais sind Kombinationen von Mesotrione plus Terbuthylazin und Mesotrione plus Pyridate, gefolgt von Thiencarbazone effektiv. Auch die Vorlage von Thiencarbazone, gefolgt vom ein- bis zweimaligen Einsatz von Mesotrione plus Pyridat hat gute Wirkungen gezeigt. Eine sehr späte Aussaat (ab Anfang Juni) und vorherige wiederholte mechanische Bearbeitung (Egge) sind sinnvoll.
In Getreide sind florasulamhaltige Herbizide zu bevorzugen. Nach der Ernte sollte eine Stoppelbearbeitung in Verbindung mit glyphosathaltigen Mitteln erfolgen. Besonders sollte auf Befall in den Fahrgassen geachtet werden.
In Zuckerrüben ist ausschließlich Conviso One wirksam (nur in toleranten Sorten). Flaches Hacken im Reihenzwischenraum schneidet das Erdmandelgras ab und schwächt die Pflanze.
Fazit
• Die Verschleppung von mit Mandeln verseuchter Erde ist zu verhindern, Maschinen sind zu reinigen.
• Einzelpflanzen ausgraben und entsorgen
• Ausbaggern kleiner Befallsstellen auf 30 cm Tiefe, Erde entsorgen
• kleine Teilflächen für zwei bis drei Jahre aus der Produktion nehmen
• Flächen mit starkem Befall: Schwarzbrache oder späte Maisaussaat mit vorheriger häufiger flacher Bodenbearbeitung
• gegebenenfalls zwei bis drei Jahre als Grünland nutzen mit häufiger Mahd