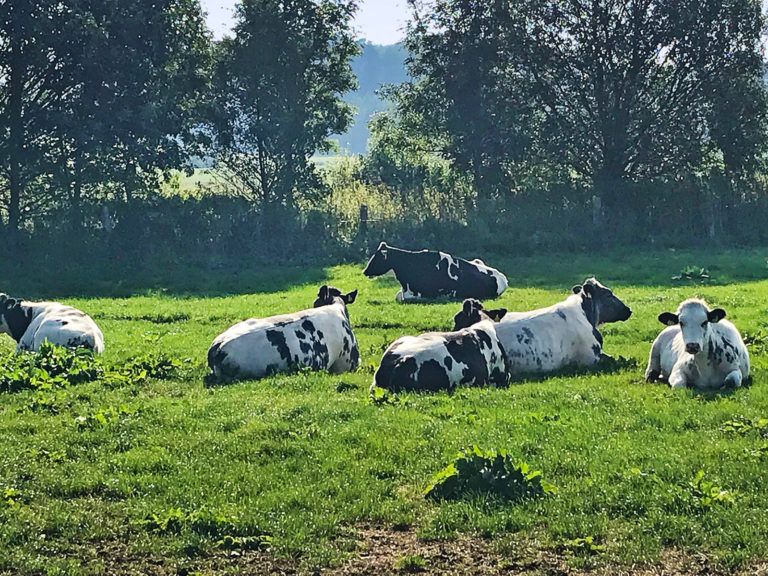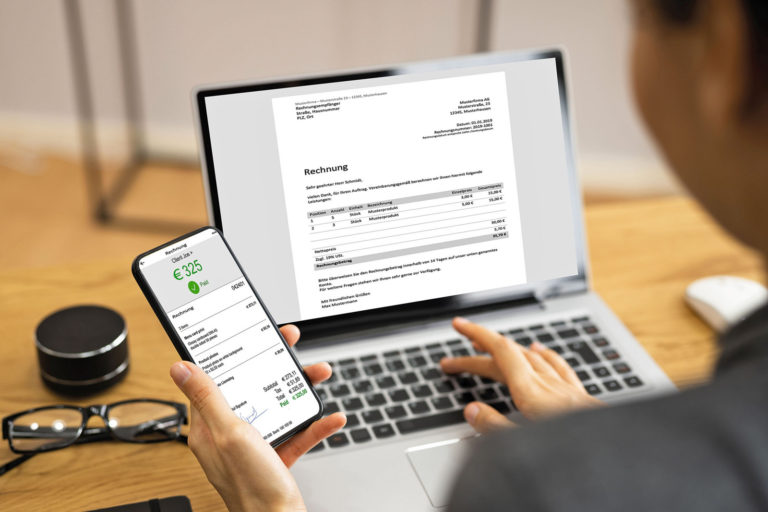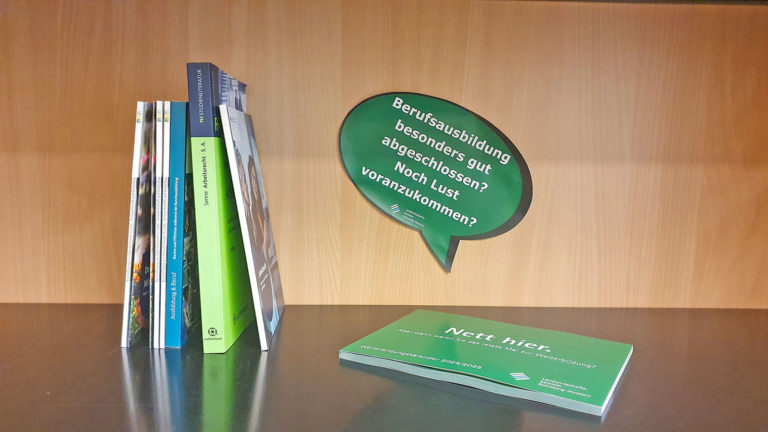Klimafreundlich, klimaneutral oder sogar klimapositiv – Klimaschutz als Verkaufsargument ist wichtiger denn je. So haben sich viele Unternehmen der Milchwirtschaft ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Einige möchten sogar bis 2050 klimaneutrale Milch verkaufen. Da der Großteil der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) eines Milchproduktes auf dem landwirtschaftlichen Betrieb entsteht, betreffen die Ziele vor allem die Milchproduktion auf den Höfen. Doch gibt es eine klimaneutrale Milch überhaupt?
In der Milchviehhaltung gibt es viele verschiedene und unterschiedlich wirksame Stellschrauben, um THG-Emissionen zu reduzieren. Dennoch verbleiben Emissionen, die nicht komplett vermieden werden können, wie zum Beispiel Methan aus der Verdauung der Kühe. Um klimaneutrale Milchprodukte zu erhalten, müssten die nicht vermeidbaren Treibhausgase kompensiert werden. Bei der Kompensation werden bereits entstandene Treibhausgase ausgeglichen, indem der Luft an anderer Stelle CO2 entzogen und zum Beispiel als Humus oder in anderen außerlandwirtschaftlichen CO2-Speichern gespeichert wird.
Humus ist in terrestrischen Ökosystemen der größte Speicher für organischen Kohlenstoff. Damit Humus entstehen kann, muss der Boden mit Biomasse „gefüttert“ werden, zum Beispiel mit Ernterückständen. Humus befindet sich in einem ständigen Auf- und Abbau. Je nach Standort sind die Humusvorräte sehr unterschiedlich. Moorböden sind hier absolute Spitzenreiter. Sie speichern fünfmal mehr Kohlenstoff als Mineralböden. Unter den Mineralböden zeigt sich, dass Grünland 40 % mehr Kohlenstoff speichert als Ackerland.
Milchviehbetriebe besitzen in der Regel viel Grünland. Bedeutet das jetzt, dass jeder Milchviehbetrieb seine (verbleibenden) Emissionen mit dem Humus im Grünland kompensieren kann? Ganz so einfach ist es leider nicht, denn es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, damit es sich tatsächlich um eine Kompensationsleistung handelt (siehe Text unten).
Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gibt es theoretisch verschiedene Möglichkeiten, um Kompensationsleistungen zu erbringen.
Dauergrünland: Dauergrünland ist ein Kohlenstoffspeicher und keine automatische Senke für zusätzlichen Kohlenstoff. Ohne zusätzliche Maßnahmen wird kein zusätzlicher Kohlenstoff im Boden gespeichert, sondern der Humusanteil bleibt bestenfalls stabil. Gutes Grünlandmanagement ist hierbei wichtig. Zusätzlichen Kohlenstoff im Grünland zu speichern, funktioniert eigentlich nur (Dauergrünlanderhalt vorausgesetzt) über eine höhere Düngung. Je mehr gedüngt wird, desto mehr Humus wird gebildet und desto mehr Kohlenstoff wird gespeichert.
Aber zu viel Dünger hat natürlich an anderer Stelle negative Auswirkungen auf die Umwelt, kostet viel Geld, und die Ausbringungsmenge ist gesetzlich begrenzt. Gleichzeitig entstehen durch den Einsatz von Mineraldünger Emissionen in der Düngemittelproduktion und als Lachgas nach der Ausbringung. Dadurch werden die positiven Effekte der Kohlenstoffspeicherung komplett zunichtegemacht.
Organischer Dünger ist in der Regel nur in begrenzten Mengen verfügbar. Mehr organischer Dünger auf einer Fläche führt automatisch zu weniger Dünger auf anderen Flächen (Verlagerungseffekt). Der zusätzliche Humusaufbau auf den mehr gedüngten Flächen führt dazu, dass auf den weniger gedüngten Flächen kein oder weniger Humusaufbau stattfindet. Somit kann es nicht als Kompensationsleistung angerechnet werden.
Pflanzen von Hecken
Hecken können deutlich mehr Kohlenstoff speichern als landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im Vergleich zu Ackerland können Hecken 104 t/ha mehr Kohlenstoff in der Biomasse und im Humus speichern, das meiste davon in der Biomasse von Heckenwurzeln und Ästen. Im Vergleich zu Grünland wird gleich viel im Humus, aber 87 t/ha mehr Kohlenstoff in der Biomasse gespeichert. Das ist die Gesamtmenge, die über einen bestimmten Zeitraum (zum Beispiel 50 Jahre) gebunden wird. Diese Menge kann einmalig angerechnet werden. Die Kohlenstoffspeicherung von Hecken ist kaum reversibel, da Hecken gesetzlich geschützte Landschaftsbiotope sind. Außer der Klimaschutzwirkung zeigen Hecken viele weitere positive Synergien, zum Beispiel die Förderung der Biodiversität oder den Erosionsschutz.
Pflanzen von Bäumen auf Weiden
Die Pflanzung von neuen Bäumen, zum Beispiel Streuobst auf einer Wiese, bindet CO2 in der Biomasse. Im Bodenkohlenstoff kommt es zu keinen Vorratsänderungen. Nach einer bestimmten Zeit werden Bäume gerodet oder gehen ein und werden durch neue ersetzt. Bei Streuobstbäumen ist von einem Zeitraum von 80 Jahren zwischen Pflanzung und Rodung auszugehen (Umtriebszeit). Als klimarelevante CO2-Bindung muss die mittlere Biomasse über die Umtriebszeit angesetzt werden. Basierend auf Daten für Apfel- und Birnenstreuobst speichert ein Baum in Wurzeln und oberirdischer Biomasse im Mittel 0,27 t Kohlenstoff oder rund 1 t CO2. Pro Baumpflanzung kann diese CO2-Senke einmal angerechnet werden.
Pflanzenkohle bindet Kohlenstoff
Pflanzenkohle ist eine technische Maßnahme zur langfristigen Bindung von Kohlenstoff. Sie entsteht durch die Verkohlung von Biomasse. 1 t Pflanzenkohle bindet zirka 1,5 t CO2 langfristig. Pflanzenkohle kann im landwirtschaftlichen Betrieb vielseitig eingesetzt werden, zum Beispiel als Gülle-, Boden- oder Futterzusatz.
Berechnungen auf einem Beispielbetrieb zeigen, wie die Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden können.Es wurde bereits deutlich, dass das Dauergrünland als anrechenbare Kompensationsmaßnahme nicht geeignet ist.
Beispielbetrieb:
• 100 Milchkühe
• Jahresleistung: 8.500 kg energiekorrigierte Milch pro Kuh
• CO2-Außstoß des Betriebes: 1,1 kg CO2äq/kg Milch.
Damit müssten für jede Milchkuh pro Jahr 9.350 kg CO2äq Emissionen kompensiert werden, das entspricht 935 t CO2äq für 100 Milchkühe.
Kompensation mit Heckenpflanzung: 1 m2 neuer Hecke lagert im Mittel insgesamt 38 kg CO2 in Humus und Biomasse zusätzlich im Laufe von zirka 50 Jahren ein.
Ergebnis: 246 m2 neuer Hecke pro Milchkuh pro Jahr. Für alle Kühe in 20 Jahren: 49 ha neuer Hecken.
Kompensation mit Baumpflanzung: Ein neuer Streuobstbaum in der Agrarlandschaft lagert im Mittel 990 kg CO2 in Biomasse ein.
Ergebnis: Rund neun neue Bäume pro Milchkuh und Jahr. Für alle Kühe in 20 Jahren: rund 18.900 Bäume neu pflanzen.
Kompensation mit Pflanzenkohle: 1 t Pflanzenkohle (aus Pyrolyse bei 500 bis 550 °C) bindet im Mittel 1.518 kg CO2 langfristig stabil.
Ergebnis: 6,2 t Pflanzenkohle pro Milchkuh und Jahr (Kosten aktuell: zirka 3.000 €). Für alle Kühe in 20 Jahren: 12.400 t (zirka 6 Mio. €) Pflanzenkohle (hier wurde mit gerundeten Werten gerechnet).
Für den Beispielbetrieb bedeutet dies, dass in 20 Jahren entweder 49 ha Hecke oder 18.900 neue Bäume gepflanzt werden müssten. Die Kompensation mit Pflanzenkohle würde einen hohen finanziellen Aufwand bedeuten. Klimaneutrale Milch scheint somit kaum umsetzbar zu sein. Es lässt sich festhalten: Das Kohlenstoffsenkungspotenzial der Landwirtschaft wird oft überschätzt. Für das Klima ist es besser, wenn die Emissionen gar nicht erst entstehen. Deshalb sollte die Reduktion von Emissionen immer Vorrang haben. Dafür gibt es auf den Betrieben viele verschiedene Stellschrauben, zum Beispiel das Güllemanagement. Die jeweils passenden Stellschrauben sind betriebsindividuell auszuwählen. Trotzdem können Kompensationsmaßnahmen einen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten. Außerdem sind Maßnahmen zum Humusaufbau oder das Einbringen von Agrarholz mehr als Klimaschutz. So ist Humus der zentrale Indikator für die Bodenfruchtbarkeit. Hecken und Bäume in der Agrarlandschaft fördern die Biodiversität und ein ausgeglicheneres Klima. Maßnahmen sollten daher nie nur unter dem Aspekt des Klimaschutzes betrachtet werden, sondern auch die weiteren positiven Effekte mit einbeziehen.
Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um Humus im Boden als Kompensation anrechnen zu können?
1. Dauerhaftigkeit: Humus muss dauerhaft im Boden gespeichert werden, um seine volle Klimaschutzwirkung zu erzielen. Sobald Maßnahmen zum Humusaufbau beendet werden, geht auch der aufgebaute Humus wieder verloren. Die Maßnahmen müssten also theoretisch dauerhaft fortgesetzt werden.
2. Zusätzlichkeit: Die Maßnahmen müssen zusätzlich zur üblichen (Humus aufbauenden) Bewirtschaftung durchgeführt werden. Nur zusätzlich gebundener Kohlenstoff ist klimawirksam.
3. Keine Verlagerungseffekte: Maßnahmen auf einer Fläche dürfen nicht dazu führen, dass der Humusvorrat auf einer anderen Fläche abnimmt oder andere THG-Emissionen zusätzlich entstehen.