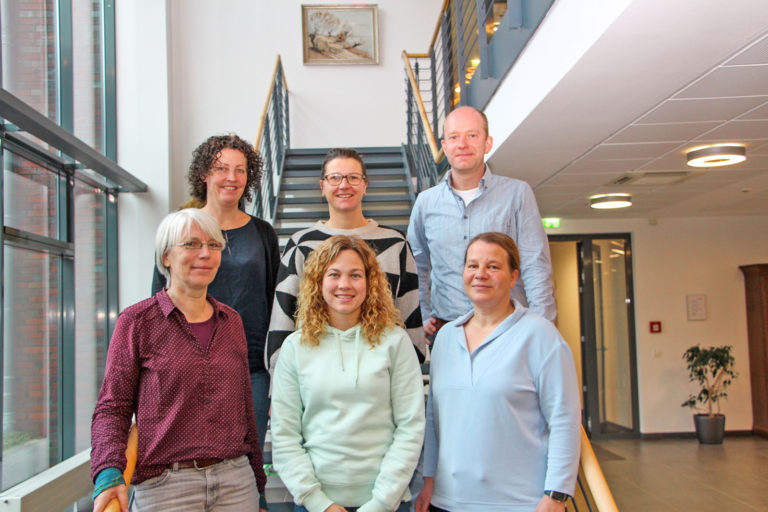kieconsent=’ignore‘ src=’https://www.bauernblatt.com//wp-content/uploads/AuroraTemplate/vendor.js’>
Die Landwirtschaftliche Rentenbank hat ihre Klimastrategie veröffentlicht. Danach will sie die Emissionsintensität ihres Landwirtschaftsgeschäftes bis 2030 um 18% auf 1,03 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Euro reduzieren. Emissionseinsparungen strebt das Förderinstitut zudem über seine Finanzierungen der erneubaren Energien und des natürlichen Klimaschutzes an. In Letzteres sollen 600 Mio Euro bis 2030 investiert werden.
FRANKFURT. Die Landwirtschaftliche Rentenbank will die Emissionsintensität ihres Landwirtschaftsgeschäftes von aktuell 1,26 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Euro um 18% auf 1,03 Kilogramm bis zum Jahr 2030 reduzieren. Das geht aus der von dem Förderinstitut am Mittwoch (8.1.) veröffentlichten Klimastrategie hervor. Ziel sei es, das Förderportfolio der Bank so auszurichten, dass die notwendige Emissionsminderung im Agrarsektor ohne wirtschaftliche Einbußen für die Branche möglich werde.Das strategische Hauptaugenmerk der Rentenbank liegt bezogen auf das Landwirtschaftsgeschäft bei der Dekarbonisierung. Zusätzlich soll aber auch der Ausbau erneuerbarer Energien vermehrt gefördert werden. So wird über das gesamte Portfolio der Rentenbank eine Emissionsreduktion von 20% bis 2030 angestrebt. Zuletzt gab es in der Förderparte der Erneuerbaren allerdings einen deutlichen Rückgang.Die in ihrer Klimastrategie formulierten Ziele für das Landwirtschafts-Portfolio sind der Rentenbank zufolge an den Sektorzielen des deutschen Klimaschutzgesetzes ausgerichtet. Gesetzt werde dabei auf einen intensiven Austausch mit den Stakeholdern und eine zielgerichtete Förderung. Denn eine Reduktion der Emissionen ohne wirtschaftliche Einbußen sei nur mit erheblichen Investitionen möglich.„Die Landwirtschaft ist systemrelevant und ein wichtiger Wirtschafts- und Resilienzfaktor für unser Land“, betonte Vorstandssprecherin Nikola Steinbock. Die Ziele des Klimaschutzgesetzes für 2020 habe die Branche bereits erfüllt, und mit der richtigen Unterstützung werde sie auch die Ziele für 2030 erreichen. Mit ihren Förderprogrammen, der Innovationsförderung und den Brancheninitiativen unterstütze die Rentenbank bereits heute landwirtschaftliche Praktiken, die zum Klimaschutz beitrügen. Daran, diesen Beitrag zu quantifizieren, will die Bank laut Steinbock ebenfalls arbeiten und ihn so sichtbar machen.
Quantifizierung der Emissionsbindung schwierig
In ihrer Klimastrategie hat sich die Rentenbank auch Ausbauziele für verschiedene Bereiche ihrer Förderung gesetzt, die sich emissionsmindernd auswirken. Dies sind zum einen die Finanzierungen der erneuerbaren Energien, zum anderen die zum natürlichen Klimaschutz. Als Beispiele nennt das Förderinstitut dabei den Erhalt von Wäldern, die Wiederaufforstung, die Wiedervernässung von Mooren, den Erhalt von Grünland und den Ökolandbau. Die Quantifizierung der Emissionsbindung durch diese Finanzierungen sei allerdings sehr schwierig, räumt die Bank ein. Entsprechend zurückhaltend gibt sie sich auch bei ihren diesbezüglichen Zielen.Geplant ist, wie in der Klimastrategie angegeben, bis 2030 insgesamt weitere 600 Mio Euro in Förderthemen mit Bezug zum natürlichen Klimaschutz zu investieren. Im Zuge des Fördergeschäftes Erneuerbare Energien sollen nach Angaben der Rentenbank kumuliert für die Jahre 2023 bis 2030 Emissionen in der Höhe von mindestens 45,001 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Im Jahr 2023 waren es hier 7,901 Mio. Tonnen, verbleiben also für den Zeitraum 2024 bis 2030 noch wenigstens gut 37 Mio. Tonnen.Neben den Emissionsminderungen ist es auch Ziel der Rentenbank, einen großen Datensatz über Anreize und freiwillige Angaben zu generieren. Die Informationen zu den Emissionen sollen es ihr ermöglichen, noch effektivere Förderprogramme zu entwickeln. Zum anderen soll dies die Kunden dazu anregen, sich mit dem Thema Treibhausgasemissionen und deren Quellen auseinanderzusetzen. Ferner soll der Kunde so Einsparpotenziale erkennen und sich auf Datenanforderungen anderer Vertragspartpartner vorbereiten können. Als erste konkrete Maßnahme dazu will die Bank in diesem Jahr ein Förderprogramm zur Erstellung von CO2-Bilanzierungen einführen. AgE