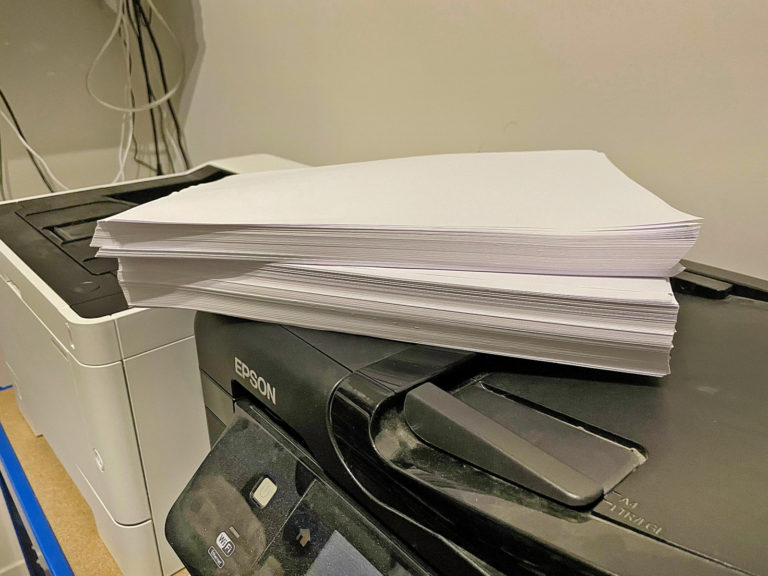Seit dem 1. Januar 2025 besteht gemäß § 14 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) die Pflicht zur elektronischen Rechnung (E-Rechnung), vergleiche Artikel von Sebastian Nehls, Ausgabe 46 vom 16. November 2024.
Kurz vor Inkrafttreten des neuen § 14 UStG fielen im November und Dezember zahlreiche Fragen und Herausforderungen an. Steuerberater, Dienstleister, Landhändler und diverse weitere Unternehmen informierten auf unterschiedliche Weisen und in unterschiedlicher Intensität über die Gesetzesänderung und ihr angestrebtes Vorgehen.
Wer ist betroffen?
Grundsätzlich ist jeder Unternehmer von der Gesetzesänderung betroffen. Ein Unternehmer ist gemäß § 2 UStG jeder, der sich mit einer nachhaltigen Tätigkeit zur Einnahmeerzielung am wirtschaftlichen Verkehr beteiligt. Hierunter fallen auch Vermieter mit gegebenenfalls nur einem Vermietungsobjekt, Kleinunternehmer, die in ihren Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen, aber auch pauschalierende Landwirte und Vereine.
Vorsteuerabzug und Kundenportale
Der Vorsteuerabzug wird bei allen ordnungsgemäßen Rechnungen gewährt. Sofern die Übergangsregelungen angewendet werden, gilt auch jede sonstige Rechnung, wie zum Beispiel eine Papier-Rechnung oder eine einfache PDF-Rechnung, als ordnungsgemäß, sofern sie alle notwendigen Rechnungsbestandteile enthält, und gewährt somit den Vorsteuerabzug. Dies wird durch Anwendungsschreiben des Finanzministeriums vom 15. Oktober 2024 explizit bestätigt.
Der Versand von E-Rechnungen kann durch E-Mails, elektronische Schnittstellen oder über den Download aus Portalen erfolgen. Beispielsweise Energieunternehmen oder Telefonanbieter stellen bereits seit Jahren ihre Abrechnungen in Kundenportalen zur Verfügung. Ein Unternehmer ist somit verpflichtet, die Abrechnungen seit 1. Januar 2025 über die entsprechenden Kundenportale elektronisch zu empfangen, und hat kein Wahlrecht mehr auf eine Papierrechnung. Die Vielzahl der Zugangsdaten stellt hierbei jedoch eine Herausforderung dar. Das Anmelden in unterschiedlichen Kundenportalen stellt zudem einen hohen administrativen Aufwand dar. Diesbezüglich wurden bereits Softwarelösungen erstellt, mit denen alle Zugänge zu Kundenportalen zusammengefasst und dort zur Verfügung gestellte Dokumente zentral abgerufen werden können. Entsprechende Rechnungsmanagementsysteme wurden bereits in einigen Softwares zur Archivierung und Verarbeitung von Belegen eingearbeitet.
Separate E-Mail-Adressen
In Bezug auf die Umstellung auf ein digitales Büro stellt sich sehr häufig die Frage, in welchem Umfang neue betriebliche E-Mail-Adressen eingerichtet werden müssen. Hierzu bestehen keine gesetzlichen Regelungen. Die Empfehlung besteht jedoch darin, dass übersichtshalber für jeden Betrieb eine separate E-Mail-Adresse für den Rechnungseingang eingerichtet wird. In diesem Zusammenhang sollten direkt alle Geschäftspartner informiert werden, sodass schnellstmöglich kein unnötiger Arbeitsaufwand durch das Einscannen von Papierrechnungen und Umspeichern von digitalen Rechnungen an andere E-Mail-Adressen mehr entsteht. Die gesamte Umsetzung in den Büros vor Ort ist jedoch vom Unternehmer und den Mitarbeitern individuell zu bestimmen und mit dem Ziel zur Zufriedenheit aller zu erarbeiten. Hierbei ist es für viele Landwirte zunächst hilfreich, die analoge Aktenstruktur in die Struktur des digitalen Büros zu übernehmen. Dies ist durch die maschinelle Lesbarkeit der Dokumente jedoch nicht notwendig.
Die Ausgangsrechnungen
Bei der Erarbeitung und Umstellung auf ein digitales Büro empfiehlt es sich, trotz der Übergangsregelungen, bereits mit dem Erstellen von E-Rechnungen zu beginnen, um diesen Prozess direkt mit einzuarbeiten und bestehende Programme für die Rechnungsschreibung auf die Möglichkeit der E-Rechnung zu prüfen.
Revisionssichere Archivierung
Elementar ist, dass elektronisch eingehende Belege in ihrer Ursprungsform revisionssicher abgespeichert werden. Dies stellt für Unternehmen, die bisher in ihrem Büro überwiegend in Papierform gearbeitet haben, eine Herausforderung dar, denn das Ausdrucken und Abheften einer elektronisch eingegangenen Rechnung ist keinesfalls ausreichend. Auch das bloße Abspeichern von Eingangsrechnungen im E-Mail-Postfach oder dem Windowssystem erfüllt die Anforderungen der Unveränderbarkeit nicht. Die gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung von Rechnungen und Gutschriften in ihrem Original-Format besteht bereits seit 2019. Hierzu wurden keine Änderungen beschlossen. Die entsprechende Aufbewahrung ist durch die Gesetzesänderung des § 14 UStG jedoch verstärkt in den Fokus gerückt. Nach der Archivierung in entsprechender Software, die eine GoBD-konforme (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung) Aufbewahrung sicherstellt, ist jegliche Bearbeitung der Dokumente möglich, da dies in der Revisionshistorie hinterlegt wird. Das Arbeiten mit Kommentaren und Notizen auf Belegen ist für viele Unternehmer sehr hilfreich für die Zusammenarbeit mit Angestellten und Familienangehörigen im Büro.
Kompatible Softwarelösungen
Wer bereits in der Vergangenheit sein Büro papierlos umgestellt hat, verwendet gewöhnlich eine mit dem Steuerberater kompatible Software zur Verarbeitung und Archivierung der Belege. Hier hinein wurden in den letzten Jahren noch viele Belege gescannt. Dies sollte nun größtenteils der Vergangenheit angehören. Eine weitere Umstellung aufgrund der E-Rechnungen ist in diesem Fall nicht nötig, da die gängigen Anwendungen mithilfe eines Zusatz-Tools die Möglichkeit bieten, E-Rechnungen zu erstellen. Diese Möglichkeit sollte zeitnah genutzt werden, um bis zum Ende der Übergangsregelungen einen eingespielten Ablauf im Büro erarbeitet zu haben. Sollte die verwendete Software die Erweiterung auf E-Rechnungserstellung nicht vorsehen, empfiehlt es sich bereits zum aktuellen Zeitpunkt, sich mit einer neuen Software auseinanderzusetzen.
Unternehmer, die bisher nicht papierlos gearbeitet haben, stehen vor der Frage, welches System für die Verarbeitung der E-Rechnungen das Richtige sei. Hierzu sollte mit dem Steuerberater Rücksprache gehalten werden, um kompatible Schnittstellen zu nutzen.
X-Rechnung oder ZUGFeRD
Bei ZUGFeRD-Rechnungen ist der Inhalt im PDF-Dokument für das menschliche Auge erkennbar, das strukturierte Datenformat befindet sich lediglich im Hintergrund. Hingegen besteht die X-Rechnung ausschließlich aus der elektronischen Datei, aus der das menschliche Auge den Inhalt nicht erkennen kann. In welchem Umfang und in welcher Häufigkeit X-Rechnungen anstatt ZUGFeRD-Rechnungen versendet werden, ist bisher noch nicht absehbar. ZUGFeRD-Rechnungen bieten jedoch den Vorteil, dass sie ohne weitere technische Lösung für das menschliche Auge sichtbar sind.
Bar-/Kartenzahlungen in Baumärkten
Kleinbetragsrechnungen unter 250 € dürfen weiterhin als Kassenbon ausgegeben werden. Bei einer Überschreitung der Grenze von 250 € muss nach den Übergangsregelungen eine E-Rechnung ausgestellt werden, wenn ein Unternehmer im Baumarkt oder Supermarkt im Rahmen seines Unternehmens einkauft. Bei einigen Märkten bestehen bereits Kundenkonten für Unternehmer. Voraussichtlich wird sich dieses System bei diversen Märkten durchsetzen. Auch Lösungen mit einem QR-Code-Scan via Smartphone oder App-basierte Lösungen sind denkbar. Um sich das Einscannen von Bar- beziehungsweise EC-Quittungen in einem heutigen digitalen Büro bereits zu ersparen, sollte vor dem Einkauf in entsprechenden Märkten der Wunsch einer digitalen Quittung an der Information geäußert werden, sodass die Mitarbeiter im Vorwege agieren und einen Unternehmer als solchen identifizieren können.
Was ist mit Dauerrechnungen?
Nach Ablauf der Übergangsfristen müssen zwingend alle Dauerrechnungen, die zwischen zwei Unternehmern geschlossen wurden, bis zu ihrer nächsten Veränderung einmalig als E-Rechnung erstellt werden. Dies gilt für (umsatzsteuerpflichtige) Pachtverträge ebenso wie für sämtliche Verträge zwischen zwei Unternehmern, in denen eine Dauerrechnung enthalten ist. Für losgelöste Dauerrechnungen gilt das Gleiche.
Fazit
Mit der E-Rechnung wird das gesetzliche Ziel verfolgt, die Digitalisierung und Standardisierung auf den Betrieben zu fokussieren. Hierbei ergeben sich für die Unternehmen Chancen zur Umstellung, die individuell genutzt und angepasst werden können.