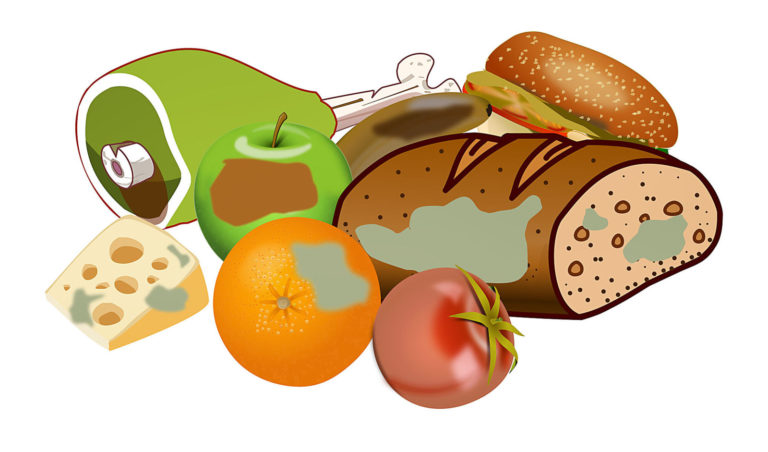Wie das Zusammenwirken von Regenerativer Stromerzeugung und landwirtschaftlicher Produktion heute und in Zukunft aussehen kann, lässt sich auf dem Green-Tec-Campus in Enge-Sande im Kreis Nordfriesland in der Praxis erfahren. Eine Vorführanlage mit drei unterschiedlich hohen, zum Teil unterfahrbaren Photovoltaik (PV)-Aufständerungen gibt einen Eindruck davon, wie eine Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen aussehen kann – und welche Vorteile sich für Flächeneigentümer und Landwirte ergeben.
Auf dem Gelände eines ehemaligen Bundeswehrdepots unweit der B 5 befindet sich die Demoanlage des Unternehmens Sunfarming. Projektmanager Stephan Franke bezeichnet sie als Auszug dessen, was auf einer großen Anlage des Unternehmens im brandenburgischen Rathenow zu sehen sei, auf der der Anbau von Kräutern und Sonderkulturen, der Futter- und Weinbau und verschiedene Formen der Tierhaltung unter PV-Anlagen erforscht werden. „Hier in Enge-Sande sind alle drei Bauformen zu sehen. Wir wollen, dass sich die Leute erstmalig mit dem System vertraut machen können“, erläutert der Agrarökonom. „Es geht nicht darum, Landwirtschaft ohne PV und Landwirtschaft mit PV zu vergleichen. Hier geht es darum, Freiflächenphotovoltaik zu vergleichen mit Freiflächenphotovoltaik mit einer Doppelnutzung“, betont Franke. Das Konzept biete unterschiedliche Möglichkeiten einer agrarischen Nutzung bei genehmigungsfähigen Konstruktionsmaßen.
Einfache Technik mit Besonderheiten
Eines der drei Modelle beginnt auf einer Höhe von 1 m und endet auf 2,40 m, womit es sich kaum von Standard-Freiflächenanlagen (FFA) unterscheidet und im Gegensatz zu den weiteren Bauformen nicht unterfahrbar ist. Die beiden anderen, für Landwirte interessanteren Höhen reichen von 1,50 m auf 3 m sowie von 2,10 auf 3,50 m und sind so mit kompakten (Kommunal-)Traktoren mit umgeklapptem Überrollbügel oder auch Kabine unterfahrbar.
Allen drei Versionen gemein ist die Teillichtdurchlässigkeit von etwa 15 % durch bifaciale Glas-Glas-Module und eine Wasserdurchlässigkeit: „Wir bringen das Wasser in eine Querverteilung unterhalb der Module“, erläutert Franke, „indem wir C-Profile, die darunter montiert sind, in Längsrichtung mit Langlöchern versehen.“ Der Regen läuft die auf Lücke gesetzten Module herunter und wird von den C-Profilen aufgenommen. „Das Wasser tänzelt entlang der Langlöcher, bis der Tropfen durch die Adhäsionskraft zu schwer wird und hinunterfällt“, erklärt Franke während eines wie bestellt einsetzenden Regenschauers.
Die Tänzelbewegung, wie er sagt, bewirke, dass das Wasser nicht an derselben Stelle hinuntertropfe, sondern sich eine Art Tröpfchenbewässerung in Reihenform ergebe. Der Schatten unter den Modulen sorgt zudem dafür, dass sich Feuchtigkeit an den Pflanzen und im Boden länger hält. Die in den Untergrund gerammten Aufständerungen kommen dabei ohne Fundament aus. Diagonale Streben sorgen für zusätzliche Stabilität. Probleme mit Windlasten oder großen Tieren habe es bislang keine gegeben. In Brandenburg teste das Unternehmen erfolgreich unter anderem die Haltung von Mutterkühen unter den PV-Elementen, die den Tieren nicht nur Schatten spenden, sondern etwa auch Heuballen als Wetterschutz dienen. Für verschiedene Kulturpflanzen bieten die Module ebenso einen Hagel- und Starkregenschutz sowie eine Teilbeschattung.
Kompromisse, die es wert sein können
Auch wenn es bei dieser Form der Landwirtschaft Kompromisse in der Produktion pflanzlicher oder tierischer Erzeugnisse gebe, bleibe durch die Doppelnutzung aber weiterhin die größtmögliche Energieausbeute durch die PV-Module erhalten. Zwar reichten die 15 % Lichtdurchlässigkeit nicht für die Photosynthese, aber die Pflanzen erhalten ihren Lichtreiz für das Höhenwachstum und bekommen den Rest durch Strahlung von der Seite. Auch dies sei durch die Hochaufständerung lösbar: „Wir haben erhöhte Kosten im Bau, aber in unseren Augen ist es das wert, allein aus der Lebensmittelerhaltungsperspektive“, hebt Franke hervor. Dies habe auch mit der Frage der Bürgerakzeptanz zu tun.
Der Ansatz Agri-PV werde schnell als „nette Idee“ abgestempelt, der die Praxisreife abgesprochen werde. Während einer der nach Anmeldung möglichen Führungen über die Anlage werde jedoch schnell deutlich, welche Potenziale Agri-PV biete. Mit Blick auf diese Möglichkeit einer Doppelnutzung würde auch manche Diskussion um die guten Böden im Land vermutlich anders geführt als bei Standard-PV-FFA-Projekten. Aktuell würden viele Flächeneigentümer im Land durch Pachtangebote für Standard-FFA aufgescheucht und zu manchmal überhasteten Unterschriften gebracht. Werde dann die Standardanlage nach 30 Jahren abgebaut, sei der Ackerstatus verloren – die Fläche hat massiv an Wert eingebüßt.
Für Franke lautet das schlagkräftigste Argument daher: „Je höher der Bodenwert, desto notwendiger die landwirtschaftliche Produktion.“ Denn: Der Status der Fläche als Ackerland bleibe erhalten, die wendende Bodenbearbeitung sei bei den unterfahrbaren Aufständerungen mit 3 oder 4 m Arbeitsbreite möglich. Diese lasse sich zudem in ein landwirtschaftliches Konzept, etwa durch den Anbau spezieller Kulturen oder eben der Tierhaltung, integrieren.
Die Landwirte hätten allgemein den Wunsch, maximale Höhe zu fahren. Mit Blick auf die Zukunft sagt Franke: „Wir sind an dem Punkt, an dem wir ein unterfahrbares System in den Markt bringen. Für viele Verbraucher mag es heute noch nicht vorstellbar sein, aber wir werden in den kommenden zehn Jahren marktfreife Agrarroboter haben. Die erhalten dadurch sogar noch einmal Auftrieb, da sie einen echten Markt bekommen.“ Landwirte und Bürger seien zudem häufig der Ansicht, dass niemand Lust habe, unter einer solchen Anlage zu fahren.
Langfristige Entscheidung von großer Tragweite
Franke gibt dabei zu bedenken, dass die Anlage 30 bis 50 Jahre auf der Fläche stehe. Vielleicht sei in den nächsten Jahren nicht die optimale Produktion möglich, aber spätestens wenn die Robotik da sei, ärgerten sich die Flächeneigentümer über ihre Standardanlagen, unter denen keinerlei Bewirtschaftung möglich sei. Das Unternehmen Sunfarming könne am Markt nur bestehen, so Franke, weil es die gleichen Pachten zahle wie bei einer Standardanlage. In beinah jedem Projekt finde das Unternehmen bereits heute Landwirte, die Lust auf diese Form der Bewirtschaftung hätten – meist Bio- oder kleinere Betriebe. Dabei müsse es sich nicht um den Flächeneigentümer selbst handeln. Das Unternehmen bietet hier unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten an.
„Selbst wenn man sich heute nicht vorstellen kann, darunter zu wirtschaften, muss man sich die Option offenhalten“, blickt Franke nach vorn. Denn sei die Anlage erst einmal gebaut – niedrig –, stehe und bleibe sie. „Dann ist überhaupt nichts mehr mit Produktion.“ Seine Botschaft lautet: „Jeder Landwirt, der über Photovoltaik nachdenkt, sollte sich einmal Agri-PV angesehen haben, bevor er sich entscheidet. Denn was steht, das steht.“