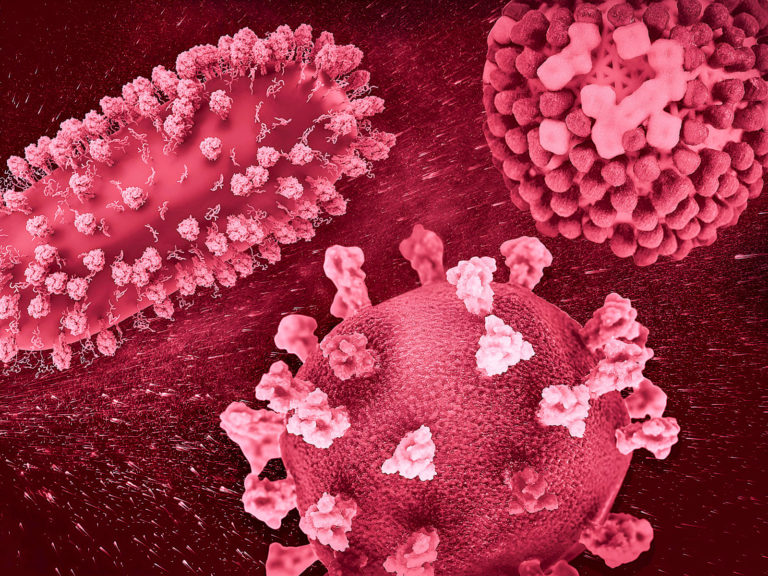Ab dem 1. Februar 2025 muss auch auf dem Grünland Gülle mit bodennahen, streifenförmigen Verteiltechniken ausgebracht werden. Einerseits gilt es, Ammoniakemissionen zu reduzieren, andererseits muss auf eine gute Futterhygiene geachtet werden. Was hierbei zu beachten ist, beschreibt der folgende Beitrag.
Bei der Gülleausbringung können Partikel- und Faserreste am Grasbestand haften bleiben und das Futter verunreinigen. Aus der Praxis kommen besonders in Jahren, in denen Sommertrockenheit auftritt, vermehrt Vorbehalte und Verunsicherungen im Hinblick auf die sichtbaren, eingetrockneten Güllebänder beim Einsatz von Schleppschuh- und Schleppschlauchverteilern.
Weniger Futterverschmutzung
Die in der Gülle enthaltenen Feststoffe werden bei der streifenförmigen Ablage in vier- bis fünffacher Konzentration im Band abgelegt und sind somit gegenüber der Breitverteilung deutlich länger sichtbar. Daher verbleibt dem optischen Eindruck nach zur Grasmahd mehr Gülle am Pflanzenbestand als bei der Breitverteilung. Doch auch bei der Breitverteilung bleiben die Güllepartikel am Gras haften. Sie sind nur aufgrund der flächigen Verteilung nicht sofort sichtbar. Diese anhaftenden Güllereste können mit dem Gras nach oben wachsen und bei der Ernte ins Siliergut gelangen. Insbesondere Gülle oder Gärreste mit höheren Stroh- und Faseranteilen sind hiervon betroffen. Hier verkleben und verketten sich die Faserpartikel in Trockenperioden eher im eintrocknenden Gülleband und werden auch bei später auftretendem Regen nur schwer wieder aufgelöst. Bisher gibt es keinen Hinweis darauf, dass emissionsarme, streifenförmige Ausbringverfahren zu einer höheren Futterverschmutzung führen als breit verteilte Gülle oder Gärreste.
Silagequalität fördern
Nach der Gülleausbringung steigen die Gehalte von Clostridiensporen und Keimen auf dem Grasbestand zunächst an. Sie reduzieren sich in den darauffolgenden Wochen aber wieder erheblich, sodass die Pflanzen zum Zeitpunkt der Ernte nur noch in geringem Maße belastet sind. Daher sollten zwischen Gülleausbringung und nächster Schnittnutzung mindestens drei bis vier Wochen liegen. Dies ist insbesondere beim zweiten und dritten Schnitt im Sommer von Bedeutung. Probleme gehen nach bisherigen Erkenntnissen eher von bodenbürtigen Clostridien durch Erdanhaftungen aus. Generell sollten alle Maßnahmen zur Erzielung einer hohen Qualität der Anwelksilage umgesetzt werden, um eventuelle Probleme durch Clostridien und Keime abzupuffern. Ziel im Gärverlauf ist eine optimale Förderung der Milchsäurebakterienvergärung. Die zügige Schaffung von anaeroben Verhältnissen und eine rasche pH-Wert-Absenkung sind zur Unterdrückung von Schadkeimen und Buttersäurebildnern dafür zwingend erforderlich. Ist ein sicherer Silierprozess nicht gewährleistet, sollten gezielt Silierhilfsmittel zur Unterstützung der Milchsäurevergärung eingesetzt werden. In Forschungs- und Praxisuntersuchungen zeigten sich nur geringe bis keine Unterschiede in den Keimzahlen und Clostridiengehalten zwischen den Ausbringtechniken Breitverteilung, Schleppschuh- und Schlitzscheibenverfahren. Tendenziell waren die Werte der Breitverteilung etwas höher und die der Schlitztechnik etwas geringer im Vergleich zum Schleppschuhverfahren. Von entscheidender Bedeutung für die Silagequalität waren dagegen die Witterungsbedingungen während des Graswachstums im Erntejahr. Lange Trockenperioden und stark wechselnde Wetterverhältnisse mit hohen Temperaturen und zahlreichen Niederschlägen verringerten den natürlichen Besatz an Milchsäurebakterien auf dem Anwelkgut. Durch Zusatz eines entsprechenden Siliermittels konnten die Silagequalitäten deutlich verbessert werden.
Auch der Schnittzeitpunkt, die Schnitthöhe und die Erntetechnik haben einen Einfluss auf die Clostridienanzahl. Herbstschnitte, zu geringe Schnitthöhen und zu tief eingestellte Aufnahmeeinrichtungen der Erntegeräte bergen die Gefahr von Erdanhaftungen. Diese können zu einem erhöhten Clostridienbesatz im Erntegut führen.
Gülle muss auf den Boden
Flüssige Wirtschaftsdünger sollten so rasch wie möglich von den Pflanzen abfließen und in den Boden eindringen. Dadurch werden nicht nur die Ammoniakemissionen reduziert, sondern auch die Gefahr der Futterverschmutzung vermindert. Dies hängt maßgeblich von der Ausbringtechnik und der Fließfähigkeit der ausgebrachten Gülle ab. Aber auch die Höhe und Dichte des Pflanzenbestands sind von Bedeutung.
Schleppschläuche gleiten über die Grasstoppeln, wodurch die Gülle auf dem Pflanzenbestand abgelegt wird. Um die Futterverschmutzung möglichst gering zu halten, sollten Schleppschläuche direkt nach der Mahd auf dem noch nicht angewachsenen Grasbestand eingesetzt werden. Damit ist das Ausbringzeitfenster für einen optimalen Einsatz sehr klein. Das aufliegende Gülleband kann bei trockensubstanzreicher Gülle zudem leicht nach oben wachsen. Schleppschläuche sollten daher im Grünland nur für fließfähige, trockensubstanzarme beziehungsweise separierte Gülle eingesetzt werden.
Schleppschuhe legen, je nach Bauart, die Gülle näher am Boden ab. Kann auf die Schleppschuhe ein entsprechender Bodendruck von mindestens 5 bis 8 kg je Kufe gegeben werden, teilen sich die Halme besser und die Gülle wird emissionsärmer am Boden platziert. Dies funktioniert am besten in Beständen, die nach der Mahd schon wieder etwas nachwachsen konnten. Ideal sind Kufen mit einem keilförmigen Querschnitt und einer länglichen Öffnung der Auslasstülle. Das fördert die Halmteilung und die bodennahe Gülleablage in einem schmalen Band. Das Ganze funktioniert jedoch nur bei nicht zu hohen Güllemengen bis maximal 20 m³/ha. Die in letzter Zeit aufkommenden Doppelschuhe sollten ebenfalls mit den entsprechenden Kufen ausgestattet sein und den entsprechenden Bodendruck aufbringen. Hierfür ist aber je Meter Arbeitsbreite eine Verdoppelung des Auflagedrucks erforderlich.
Bei höheren TS-Gehalten in der Rindergülle kommt auch der Schleppschuh an seine Einsatzgrenzen. Hier sollte die Schlitztechnik zum Einsatz kommen. Hinsichtlich der Futterverschmutzung und der Emissionsminderung weist dieses Verfahren bei einer Ausbringung vom späten Frühjahr bis zum Sommer Vorteile gegenüber dem Schleppschuh auf. Die Gülleablage in den Bodenschlitz fördert die Bodeninfiltration und verringert die Futterverschmutzung. Das Ausbringfenster nach der Schnittnutzung ist größer als beim Schleppschuh. Die Grenzen der Schlitztechnik liegen im Einsatz im zeitigen Frühjahr auf sehr feuchten und wenig tragfähigen Grünlandstandorten. Bodenbeschaffenheit, Schlitztiefe und die auszubringende Güllemenge sind für einen optimalen Einsatz zu berücksichtigen.
Separierte Dünngülle
Durch die Separierung entsteht eine fließfähigere Dünngülle. Sie vermindert die Pflanzenbenetzung beziehungsweise Futterverschmutzung, fördert die Bodeninfiltration und erhöht die Stickstoffwirkung. Dieser Vorteil kehrt sich aber bei den Feststoffen ins Gegenteil um. Der Ammoniumgehalt ist nur unwesentlich gegenüber der Ausgangsgülle reduziert. Aufgrund der größeren spezifischen Oberfläche, der fehlenden Bodeninfiltration und des höheren pH-Wertes haben sie ein deutlich höheres Emissionspotenzial. Schon während der Lagerung und der Ausbringung kann ein Großteil des Ammoniums verloren gehen. Kurze Lagerzeiten und eine sofortige Einarbeitung der Feststoffe oder die Abgabe an eine Biogasanlage sind daher zwingend erforderlich.
Bevor über die Gülleseparation nachgedacht wird, sollten erst alle Möglichkeiten in der Grünlandbewirtschaftung und der Gülleausbringung für eine optimale Futterhygiene ausgeschöpft werden. Denn die Separation ist teuer. So ist, je nach separierter Güllemenge, mit Kosten zwischen 2 und 3,60 €/ m³ Gülle zu rechnen.
Weiterer Forschungsbedarf
Die bisherigen Ergebnisse zum Einfluss der Gülleausbringtechnik auf die Silagequalität weisen nur geringe Unterschiede auf. Die Erhebungen fanden bevorzugt im Süden Deutschlands, in Österreich und der Schweiz statt. Die Frage ist, ob diese Erkenntnisse auf norddeutsche Verhältnisse mit teilweise anderen Witterungsbedingungen und höheren Trockensubstanzgehalten in der Gülle übertragbar sind. Vor diesem Hintergrund ist auch ungeklärt, ob der zusätzliche technische Aufwand durch Doppelschleppschuhe hinsichtlich der Futterhygiene gerechtfertigt ist.
Fazit
• Ab dem 1. Februar 2025 muss Gülle auf dem Grünland mit bodennahen, streifenförmigen Verteiltechniken ausgebracht werden.
• Einerseits gilt es, Ammoniakemissionen zu reduzieren, andererseits muss auf eine gute Futterhygiene geachtet werden.
• Befürchtungen, dass anhaftende Güllepartikel die Silagequalität negativ beeinflussen, haben sich bisher nicht bestätigt.
• Generell sollten alle Maßnahmen zur Herstellung einer guten Silagequalität berücksichtigt werden.
• Ziel ist die Förderung der Milchsäurevergärung durch rasche Schaffung anaerober Verhältnisse und eine zügige pH-Wert Absenkung.
• So können Fehlgärungen durch eventuelle Verschmutzungen verhindert werden.