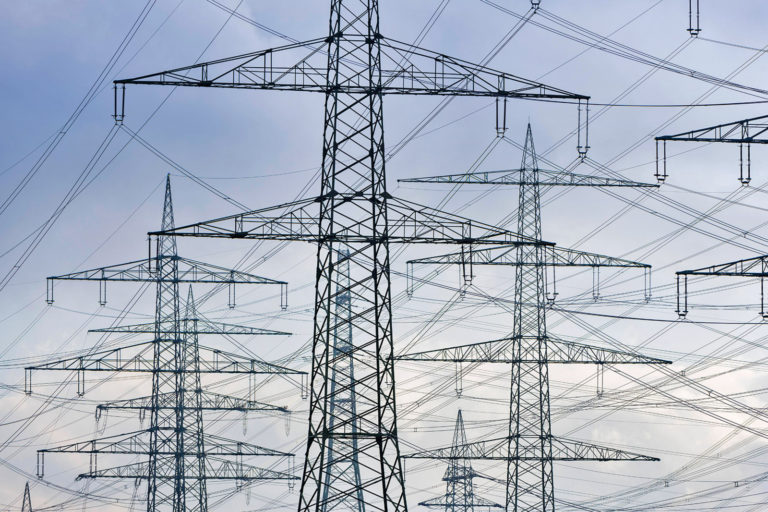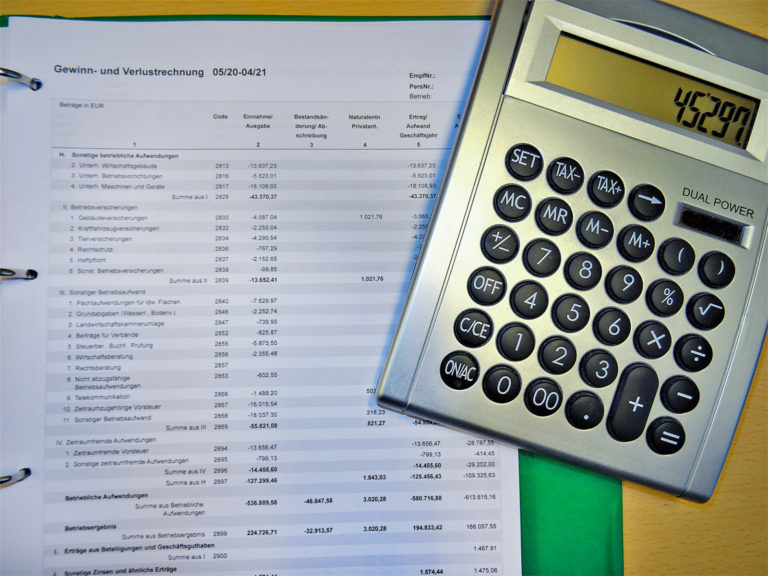In einem Online-Seminar der Persönlichen Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) referierten die Doppelolympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und ihr Bruder, der Championatskaderreiter Benjamin Werndl, zum Thema „Mehr Ausdruck und Leichtigkeit in der Dressur“. Das Seminar richtete sich an fortgeschrittene Dressurreiter, auch wenn die Basisarbeit der beiden bestimmt für alle Reiterinnen und Reiter sinnvoll wäre.
„Es passiert nicht so oft, dass wir zwei der deutschen Topsportler als Referenten für ein Seminar haben“, führte Lina Otto in den Abend ein. Bekannt seien Jessica von Bredow-Werndl und ihr Bruder Benjamin Werndl nicht nur aufgrund ihrer Erfolge, sondern auch, weil sie Aushängeschilder für harmonisches Reiten seien. „Das Thema Ausdruck und Leichtigkeit ist daher besonders spannend“, befand Otto, die als Pferdewirtschaftsmeisterin, Trainerin A sowie Ausbilderin im Reiten als Gesundheitssport und Ausbildungsexpertin der PM genau weiß, wovon sie spricht. Mit der Frage, was Ausdruck und Leichtigkeit bedeuteten, übergab sie das Wort an die beiden im bayerischen Aubenhausen beheimateten Referenten.
„Es gibt zwei verschiedene Arten von Ausdruck. Wir wollen uns heute vor allem mit dem beschäftigen, der aus der Lockerheit herauskommt“, erklärte Benjamin Werndl in seiner Einführung. Es gebe auch Ausdruck, der aus der Spannung entstehe, manchmal sogar aus der negativen Spannung. „Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen Kadenz aus der Leichtigkeit.“ Dies zu erreichen, sei mit jedem Pferd wieder eine Herausforderung.
„Als Erstes müssen die Grundvoraussetzungen stimmen“, nahm Jessica von Bredow-Werndl den Faden auf. Leichtigkeit komme aus der Losgelassenheit, aus dem Gleichgewicht und daraus, dass die Pferde gelernt hätten, sich zu tragen. Für die Entwicklung der Tragkraft wiederum brauchten die Pferde Zeit, denn sie müssten dafür alle Muskeln nutzen.
Zu diesem Thema kam später noch eine Frage auf: „Trainiert ihr die Kraftentwicklung nur über das Reiten?“, wollte einer der etwa 400 Teilnehmer wissen. „Wir haben eine Galopprennbahn, ein Ausreitgelände und einen Aquatrainer, arbeiten aber überwiegend durch das klassische Reiten“, beantwortete Jessica von Bredow-Werndl die Frage. Das dauere Monate oder sogar Jahre, aber diese Zeit müsse dem Pferd gegeben werden. Mit dem Intervall- und Konditionstraining begännen die Geschwister erst, wenn die Pferde ausgewachsen seien.
Bewegung im Schritt ist nie zu viel
Wichtig war es den Referenten, darauf hinzuweisen, dass Entwicklung nur in der Regeneration stattfinde. Pausen seien also unumgänglich. Doch das heiße nicht, dass das Pferd in der Box stehen bleibe. „Wir gehen ganz viel im Schritt. Man kann ein Pferd nicht oft genug im Schritt bewegen“, betonte von Bredow-Werndl. Den Schritt nutzen die beiden Dressurtrainer auch, um ihre Pferde zu loben. Nach einer gelungenen Lektion gibt es immer eine Schrittpause. „So können sie sich für uns mehr anstrengen“, erklärte Jessica von Bredow-Werndl.
Das Programm für ein ausgewachsenes, etwa siebenjähriges Pferd sieht auf der Anlage in Aubenhausen etwa so aus: Montag Gymnastizierung, Dienstag vor allem Trabarbeit, Mittwoch Galopparbeit und noch mal aufs Laufband. Donnerstag frei, also im Schritt in den Wald, auf die Koppel und den Paddock. Freitag Durchlässigkeitsarbeit und Übergänge, am Sonnabend dann Üben der Aufgabe oder von Ausschnitten daraus und dann Erholung. Dazu geht es mehrmals pro Woche in den Aquatrainer oder die Führanlage. Jedem Training gehen 15 min Schritt voraus, im Winter am besten länger, im Idealfall sogar eine kleine Runde im Gelände. Die eigentliche Arbeit sei dann nur eine halbe Stunde. „Länger kann ein Pferd sich nicht konzentrieren“, erklärten die beiden.
Deshalb halten sie auch die Lösungsphase möglichst kurz. „Wir beginnen mit einem simplen Warmjoggen und achten darauf, wie das Pferd heute so drauf ist“, erklärte Jessica von Bredow-Werndl. Die Lösungsphase sei dann so lang wie nötig und so kurz wie möglich, denn am Anfang sei die Konzentrationsfähigkeit am größten. Bei den Olympischen Spielen in Tokio sei Jessica ihre Dalera nur 18 min abgeritten. „Wir wollen auf dem Abreiteplatz nichts mehr üben. Das haben wir zu Hause gemacht“, erklärte von Bredow-Werndl, die damals zwei Goldmedaillen gewann.
Mit sehr feinen Hilfen arbeiten
Ein Schlüssel zur Leichtigkeit sei auch die Durchlässigkeit, also wie gut ein Pferd vorwärts, seitwärts und rückwärts am Sitz und an den Hilfen gehe. „Dazu muss man sich einfühlsam auf das Pferd einstellen und kann dann mit sehr feinen Hilfen arbeiten“, so die 36-jährige Dressurreiterin, die seit ihrem vierten Lebensjahr reitet. „Pferde merken jede Fliege am Körper. Da bedarf es keiner großen Einwirkung.“
Für die feinen Hilfen brauche es viel Körperbeherrschung und vor allem eine stabile Körpermitte. Ohne die könne die Hand nicht weich sein und der Reiter könne nicht mitschwingen. „Die feinen Hilfen müssen zu einer Selbstverständlichkeit werden“, meinte auch Benjamin Werndl.
In einem Video verdeutlichten die Geschwister unter anderem, wie die Zügelführung sein sollte: „Die Zügel sind wie Fäden, die nicht reißen dürfen. Wir ziehen nicht daran und wir tragen damit nicht das Pferd. Wir geben immer wieder vor und machen damit deutlich, dass sich das Pferd selbst tragen muss. So kommen wir zur Losgelassenheit.“ Eindrücklich demonstrierte der Reiter im Video diese Grundhaltung, indem er die Zügel nur zwischen den Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger führte.
„Kontrolle haben wir über unseren Sitz“, erklärte Jessica von Bredow-Werndl. Im Video erläuterte sie, dass sie das Pferd über den Po aufnehme und nicht über die Hand. Man müsse schwer sitzen. Sie beschrieb: „Ich spanne den oberen Bereich meiner Bauchmuskulatur und meinen Po an. Dazu kippe ich das Becken. Wir pressen oder drücken aber nicht. Wir saugen uns an.“
Das sei gerade bei Pferden wichtig, die versuchten, dem Reiter unter dem Po wegzulaufen. Das Pferd werde zwar vielleicht erst einmal schneller, darüber müsse man aber ganz liebevoll hinwegreiten. „Wenn ich bei einem hektischen Pferd auch noch alles wegstrecke, komme ich eher zu einer negativen Spannung“, sagte Werndl. Bei einem eher gemütlichen Pferd versuche er, durch Impulse vom Bein wegzukommen. Es gehe immer darum, über die Lockerheit zur Gehfreude und Losgelassenheit zu kommen.
Das Pferd von der Hand wegbekommen
Dazu gehöre auch das richtige Treiben. „Wenn ich mein Bein locker an das Pferd fallen lasse, treiben meine Beine in einem natürlichen Rhythmus. Sie schlackern dabei aber nicht herum, es ist eine unsichtbare Verbindung“, erklärte Benjamin Werndl. Wenn man versuche, bewusst in irgendeinem Moment zu treiben, sei man sowieso schon hintendran.
Eine seiner Lieblingsübungen, um das Pferd von der Hand wegzubekommen, sei es, aus einem traversartigen Arbeitsgalopp in den versammelten Galopp zu wechseln. „Am Anfang fällt das Pferd dann vielleicht mal aus, aber das ist nicht schlimm. Ich galoppiere dann einfach wieder an.“ Beide Geschwister vertreten die Herangehensweise zu loben, wenn etwas gut klappt, und es zu ignorieren, wenn etwas nicht funktioniert.
In einem weiteren Video ging es ebenfalls darum, das Pferd von der Hand wegzubekommen. Werndl erläuterte: „Wenn ein Pferd vorn drückt, liegt der Grund zu 99 Prozent hinter dem Sattel, also dass es nicht genug trägt. Ich kann das Problem nicht vorn lösen, sondern muss das Hinterbein aktivieren. Wenn ein Pferd sich wirklich trägt, ist es leicht vorn. Der Prozess kann Jahre dauern, ist aber unserer Erfahrung nach der einzige echte Weg. So komme ich zum Loslassen.“
Dazu arbeiten die Geschwister ihre Pferde zu 70 % im Galopp, weil es so leichter sei, die Pferde unter den Schwerpunkt zu arbeiten. „Da kann ich sie wirklich über den Rücken reiten. Wenn ich das im Galopp kann, ist es leichter, das Pferd im Trab zum Schwingen zu bringen“, so Werndl.
Im Video demonstrierten die Referenten eine weitere Übung, die sie gern anwenden: die Übergänge. Dabei geht es nicht nur um Übergänge zwischen den Gangarten, sondern auch innerhalb einer Gangart, und hierbei auch um eine Änderung der Frequenz des Abfußens. Dafür müsse man schneller sitzen und schneller treiben. Die Erhöhung der Frequenz sei eine versammelnde Übung. Natürlich könne man auch in der Gangart zulegen und zurücknehmen. Am Ende liege die Wahrheit dann in der Mitte. Im Video war zu sehen, wie die Stute, die anfangs eher etwas matt wirkte, durch die Arbeit mit den Übergängen an Ausdrucksstärke gewann und schließlich mit Kadenz und Ausdruck trabte.
Mit Reiterfitness das Potenzial entfalten
Es gehe dabei vor allem um das Gleichgewicht. „Wenn ich das Pferd ins Gleichgewicht bringe, wird es schöner und richtet sich auf“, erläuterte Werndl. „Das bedeutet, dass ich mein Pferd nicht treiben und nicht halten muss. Ich strecke aber nicht alles weg, sondern bin immer atmend mit meinem Pferd verbunden. Dabei kann ich so fein sein, dass mein Pferd allein mit sich zurechtkommt.“ Das sei die Grundvoraussetzung für den wahren Ausdruck.
Ein gutes Indiz sei, dass das Pferd bequem zu sitzen sei. „Wir wollen nicht auf dem Pferd, sondern im Pferd sitzen“, erklärte Jessica von Bredow-Werndl und sprach damit wieder das „Hineinsaugen“ an. Dafür brauche aber auch der Reiter die entsprechende Fitness. „Wenn wir Reiter nicht auch an der eigenen Beweglichkeit und Stabilität arbeiten, bleibt immer ein Faktor, der uns davon abhält, das volle Potenzial unserer Pferde zu entwickeln“, so die Geschwister.
Die eigene Fitness helfe auch beim Aussitzen von schwungvollen Pferden. Ansonsten könne man den Trab erst einmal kleiner halten, damit man das Pferd sitzen könne, erklärte Benjamin Werndl auf eine Teilnehmerfrage hin. Denn: „Kann das Pferd im Kleinen schwingen, kann es das auch im Großen.“
Viele weitere Fragen kamen von den Teilnehmern. Einige konnten beantwortet werden, andere blieben aufgrund der begrenzten Zeit offen. „Wir wollen euch mitnehmen auf eurer Reise“, sagte Jessica von Bredow-Werndl und fügte hinzu: „Wir haben die gleichen Herausforderungen wie ihr. Auch wir kochen nur mit Wasser. Aber wir beschäftigen uns sehr viel mit der Psyche des Pferdes und stehen für eine positive Partnerschaft.“ Die Entwicklung gehe für sie nie zu Ende. „Wir fühlen uns mitten im Prozess. Egal, mit welchem Pferd und bei welchem Ausbildungsstand“, erklärte die Reiterin.