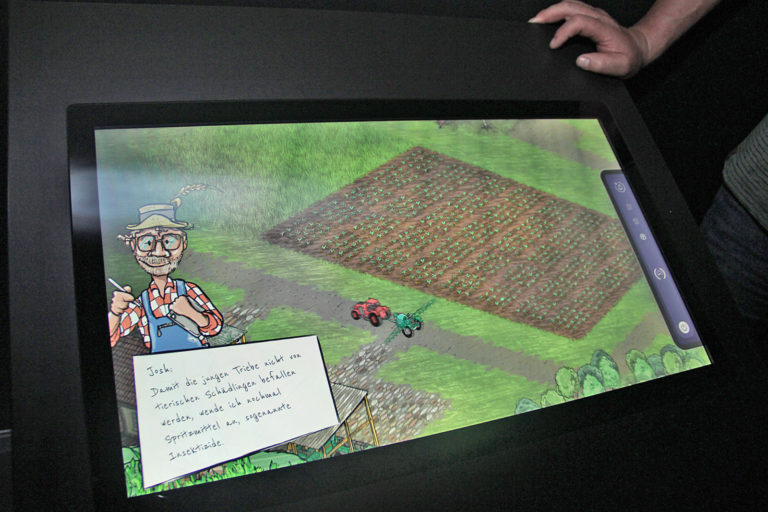Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (LKSH), hat kürzlich wieder zwei Betriebe für innovative Ansätze in der Tierhaltung ausgezeichnet. Oft sind es kleine, konsequente Maßnahmen für großen Erfolg. Den Betrieb der Familie Engelbrecht im Kreis Pinneberg haben wir bereits in der vorigen Ausgabe vorgestellt. Es folgt Betrieb zwei, der Biohof Otzen in Busdorf.
„Diese sind Beispiele für den Einklang von tiergerechter Haltung und Wirtschaftlichkeit in der Landwirtschaft“, sagte Volquardsen bei der feierlichen Ehrung im Kreis Schleswig-Flensburg. Viele fordern Tierwohl, die Betriebe im Land setzen es um und die Kammer zeigt einmal im Jahr neue Beispiele dafür.
Henning Otzen erzählt eine Anekdote. Er sei auf der Hochzeitsreise nach Frankreich nicht nur in seine Frau, sondern auch in die französische Rinderrasse Maine-Anjou verliebt gewesen. Hierzulande nahezu unbekannt, grasen sie nun auf einer idyllischen Koppel mit Blick zum Viking-Turm in Schleswig. Gute Muttereigenschaften haben die stabilen Kühe, die auch auf kargem Land zurechtkommen. Und das ist auch der Grund für die Auswahl dieser kompakten Fleischrinderrasse. Henning Otzen ist im Hauptberuf Tierarzt, und im Nebenerwerb muss die Landwirtschaft unkompliziert sein. Genauso ist die großrahmige Rasse, für die sich die Familie entschieden hat.
Dr. Walter Reulecke, Geschäftsführer des Fleischrinderzuchtverbandes, freute sich für die Familie. „Das ist eine echte Wertschätzung, denn der Anfang war nicht leicht“, berichtete er von der Bürokratie beim Einführen der ersten französischen Zuchttiere.
Auch Betriebsleiter Henning Otzen blickte zurück bei seiner Vorstellung der Tiere. Er hatte den Termin bei feinstem Wetter kurzfristig nach draußen zu seiner Herde verlegt. „Wir sind ein Biobetrieb, da ist alles immer etwas komplizierter“, verrät er und berichtet, dass er Stroh zukauft, ebenso Getreidemehl, aber auf Kraftfutter verzichtet. Das Ganze sei ein Familienprojekt, und man sei mit dem Ort verbunden. Das spiegelte sich auch darin wider, dass unter anderem der Bürgermeister und der Leiter des Wikinger-Museums Haithabu, auf das die Kühe blicken, eingeladen waren.
Was die Kammer überzeugt hat
Bereits Vater Hans-Volkert Otzen hat auf dem schwer zu bewirtschaftenden Niederungsstandort von jeher versucht, unterschiedliche Rassen wie Galloways oder Limousin zu etablieren, bis er 2008 schließlich auf die Maine-Anjou gestoßen ist. Diese rotbunte französische Fleischrasse, die sich insbesondere durch ihr sehr ruhiges, zutrauliches und umgängliches Wesen auszeichnet, wird seitdem unter dem Herdennamen „von Hedeby“ gezüchtet. Die seinerzeit gekauften Tiere bildeten die Grundlage für den heutigen Betrieb „Hof Haithabu“ mit seinen rund 40 ha Grünland und der kleinen Mutterkuhherde mit zwei Zuchtbullen.
Ziel ist es, unter Ausnutzung einer möglichst breiten Gengrundlage ein Rind mit guter Muttereigenschaft zu züchten.
Die extensive Tierhaltung ist vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels immer stärker nachgefragt. Die Weidehaltung auf Naturschutzflächen mit einem gewissen Druck an Jakobskreuzkraut ist nicht einfach. Über konsequentes Ausstechen und regelmäßiges Mulchen wird versucht, dieses zurückzudrängen. Familie Otzen sieht sich als Regionalproduzenten, die nach Möglichkeit nur das verfüttern, was auf dem eigenen Betrieb wächst.
In der Vegetationsperiode befinden sich alle Tiere auf der Weide. Im Winter stehen die Tiere hingegen in dem offenen, videoüberwachten Tretmiststall. Auch das Winterfutter (Heu und Silage) kommt vom Betrieb und wird nur um Mineralfutter sowie Möhren aus Dithmarschen als Lockfutter ergänzt.
Anerkannt hat die Kammer auch, dass Hans-Volkert und sein Sohn die Zeit finden, sich ehrenamtlich zu engagieren, und zwar als Gründungsmitglieder im Vorstand des Maine-Anjou-Verbandes Deutschland. Sie sind international vernetzt und tragen insbesondere durch ihr Fachwissen maßgeblich zur Erweiterung und Verbesserung der deutschen Population bei.
Ute Volquardsen erklärte bei der Gelegenheit, was sie unter Innovation versteht, die Grundlage des Kammerehrenpreises ist: „Sie zeigen, dass regionale Produktion, Schlachtung und Vermarktung möglich sind. Es ist eine Nische, in der Sie wirtschaften, aber Sie bieten damit Denkanstöße für andere, und darin ist der innovative Ansatz Ihres Betriebes begründet. Mit Ihrer Art der Tierhaltung beweisen Sie, dass auch auf schwer nutzbaren Niederungsflächen mit eher minderwertigem Futter qualitativ hochwertiges und schmackhaftes Fleisch produziert werden kann.“
Sachliche Diskussion gewünscht
Die landwirtschaftliche Tierhaltung steht durch den politisch und gesellschaftlich geforderten und auch von der Landwirtschaft gewollten Umbau in den kommenden Jahren vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Tierwohl und Tiergesundheit sind, wenn es um Tierhaltung geht, mit Recht die bestimmenden Themen unserer Zeit geworden. Aber auch Versorgungssicherheit ist plötzlich wieder in den Fokus der manchmal emotional geführten Diskussion gerückt. Jeder von uns ist Verbraucher und kann sich somit dieser Diskussion nicht entziehen. Deren Umfang und Komplexität, die Vielfalt der Perspektiven sowie die unterschiedlichen Interessenlagen zeigen gerade den Konflikt, der auch immer wieder Ausdruck in Protestaktionen findet.
Das Ziel der Landwirtschaftskammer sei es, so Volquardsen, genau diese Diskussion zu versachlichen und zusammen mit ihren Partnern die Grundlage für eine faktengebundene Information für Verbraucher und Landwirte bereitzustellen.
„Aber auch Politik, Lebensmittel verarbeitende Industrie und Verbraucher müssen durch ihr Handeln zeigen, dass man es ernst meint, die Landwirtschaft beim Umbau der Tierhaltung aktiv zu unterstützen. Politik muss einen langfristigen, fraktionsübergreifenden Weg aufzeigen, der den Betrieben bei ihren Investitionen in die Zukunft Planungssicherheit ermöglicht. Ställe werden eben nicht nur für fünf Jahre, sondern für 20 Jahre gebaut“, führte Präsidentin Volquardsen weiter aus.
Fazit
Trotz der durch Ukraine-Krieg, Corona-, Energie- oder Inflationskrise entstandenen extrem wechselhaften Märkte, von denen insbesondere die Landwirtschaft massiv betroffen ist, darf man nicht darauf warten, dass die unterschiedlichen Interessengruppen den Takt vorgeben. Vielmehr ist die Landwirtschaft dazu angehalten, die zukünftige Entwicklung der Branche aktiv zu gestalten. Umso wichtiger ist es, Betriebe zu haben, die neue und zukunftsweisende Ansätze mutig verfolgen und somit Denkanstöße für die Tierhalter geben. Der Lebensmitteleinzelhandel muss sich ebenso seiner Verantwortung bewusst sein, dass die selbst gesteckten Ziele, zum Beispiel ab 2030 100 % des Frischfleischsortiments aus den Haltungsstufen 3 und 4 verkaufen zu wollen, auch direkte Auswirkungen auf den Konsum und den Preis haben werden. Jedem Verbraucher muss schließlich klar sein, dass es dies nicht zum Nulltarif geben kann.