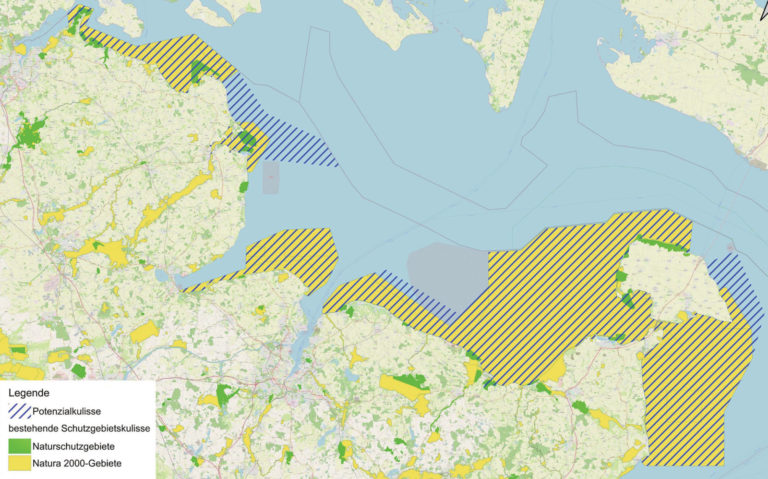Die Haushaltspläne von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und seine vorgesehene drastische Kürzung der Bundesmittel für die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) schlagen hohe Wellen des Unmuts. Die CDU/CSU-Landwirtschaftsministerinnen und -minister der Bundesländer sehen durch die drastische Kürzung der Bundesmittel für die GAK die Entwicklung des ländlichen Raumes gefährdet und haben dies in einem gemeinsamen Brief an das BMEL geäußert.
Die für Agrarpolitik beziehungsweise den ländlichen Raum zuständigen Ministerinnen, Minister und Senatorin der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein appellieren an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) in einem Schreiben, sich für den Erhalt der GAK-Mittel einzusetzen. Ziel müsse es sein, dass die Kürzungen im parlamentarischen Verfahren abgewendet würden. „Das erschüttert die Grundfesten der GAK und untergräbt das Vertrauen in die Politik“, warnte Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) als Sprecher der Ministerriege.
Die CDU/CSU-Ressortchefs bringen in dem Brief ihr Unverständnis und ihre Sorgen über die massive Mittelkürzung der GAK zum Ausdruck. Diese hätte zur Konsequenz, dass mangels ausreichender Finanzmittel zahlreiche Maßnahmen und Vorhaben aus dem Bereich der ländlichen Entwicklung in den Ländern nicht mehr realisiert werden könnten. „Die Kürzungsvorschläge des Bundeskabinetts sind für die Länder nicht hinnehmbar und untergraben massiv das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Politik“, betonte Hauk.
„Wir sehen mit den geplanten Kürzungen seitens des Bundes die Grundfesten der GAK erschüttert, was durch die bereits erfolgte Herauslösung von erheblichen Mitteln aus der GAK für ein neues Bundesprogramm im Bereich Tierwohl, für das der Bund verfassungswidrig die Zuständigkeit an sich gezogen hat, noch verstärkt wird“, so der Stuttgarter Landwirtschaftsminister.
Kofinanzierung der EU-Mittel gefährdet
Nach Ansicht der Unions-Ressortchefs gefährden die geplanten Kürzungen die bisherigen Anstrengungen für gleichwertige Lebensverhältnisse in den verschiedenen Regionen Deutschlands. Zugleich würde die weitere Verbesserung der Strukturen in den ländlichen Räumen als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräumen erheblich beeinträchtigt. Darüber hinaus würde die Kürzung der GAK-Mittel die zwingend vorgesehene Kofinanzierung von EU-Mitteln schmälern, sodass deutlich weniger Projekte gefördert werden könnten.
Schwarz sieht Lasten für den ländlichen Raum
Die GAK ist Kernbestandteil des deutschen Fördersystems für strukturschwache Regionen und zudem wesentlicher Baustein zur nationalen Kofinanzierung der EU-Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler).
„Kürzungen in diesem Bereich würden die Bemühungen aller Akteure für gleichwertige Lebensverhältnisse ausbremsen und einseitig zulasten der ländlichen Entwicklung fallen“, sagte Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU). Dies gelte gerade auch mit Blick auf die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen bei den anstehenden Transformationsprozessen im Bereich Klimawandel und Landentwicklung. „Ich appelliere daher an die Bundesregierung, die Menschen im ländlichen Raum nicht alleinzulassen, ihnen eine Perspektive zu geben und mit den Bundesländern in einen Dialog zu treten. Kürzungen, die der ländlichen Entwicklung entgegenwirken, sind nicht akzeptabel!“, so der Minister. age, mbw
GAK und Bundeshaushalt
Am 5. Juli dieses Jahres wurde der Entwurf des Bundeshaushalts 2024 in das Bundeskabinett eingebracht und beschlossen. Dieser sieht im Jahr 2024 erhebliche Kürzungen auch im Bereich des BMEL vor, wovon insbesondere die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) mit einer Kürzung in Höhe von rund 300 Mio. € Kassenmittel betroffen ist. In Schleswig-Holstein leben rund 78 % der Bevölkerung im ländlichen Raum.
Eine Woche nach der Befragung im Bundestag gab Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) auf dem Deutschen Bauerntag in Münster am 29. Juni teilweise Entwarnung. Vor den Delegierten des Deutschen Bauerntages berichtete er, dass eine Kürzung der Bundesmittel in der Gemeinschaftsaufgabe zwar nicht vom Tisch sei. Sie solle aber deutlich geringer ausfallen als zunächst vorgesehen. Es sei gelungen, die ursprünglich geplante Kürzung von 300 Mio. € zu halbieren, berichtete der Grünen-Politiker in Münster. Zugleich sagte er auf dem Bauerntag zu, dass der Bundeszuschuss zur Landwirtschaftlichen Unfallversicherung (LUV) von 100 Mio. € nicht angerührt werde. Auch eine Kürzung der Agrardieselbeihilfe sei nach wie vor nicht im Gespräch. mbw